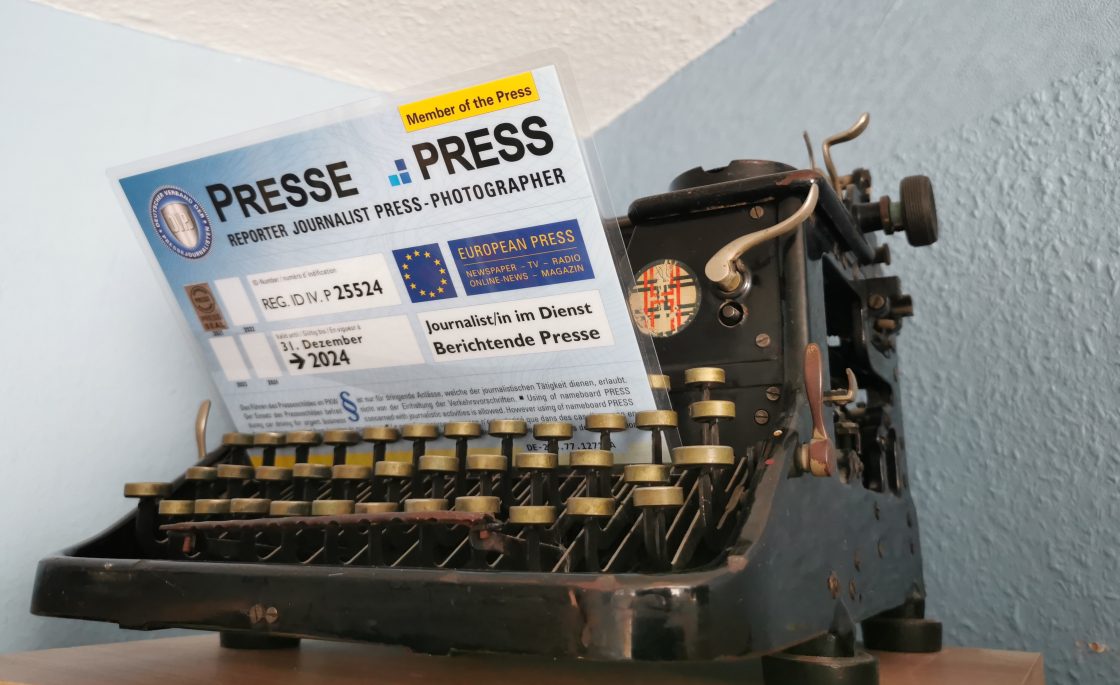Die deutsche Linkspartei zerlegt sich, das Bochumer Wagenknecht-Lager prescht bei der Spaltung schon einmal vor. Der Schritt ist unausweichlich, denn links ist an der Partei fast nichts mehr. Wie schon SPD und Grüne hat auch sie sich einer neoliberalen Front angeschlossen. Eine Analyse.
Von Susan Bonath
Nach jahrelangen Lagerkämpfen ist Die Linke in der politischen Bedeutungslosigkeit versunken. Der Flügel um Sahra Wagenknecht als schärfster Widersacher der Parteiführung will etwas Neues aufbauen, Details bleiben abzuwarten. In der Ruhrpott-Metropole Bochum geht es diesbezüglich schon hoch her. Dort wollten drei Stadträtinnen nämlich nicht auf Wagenknecht und Co. warten. Sie erklärten vergangene Woche ihren Parteiaustritt.
Wie die taz berichtete, verlieren die beiden verbliebenen Linken-Abgeordneten damit ihren Fraktionsstatus im Stadtrat. Die Abtrünnigen gaben demnach bekannt, eine neue Fraktion gründen zu wollen. Heißen solle diese „Frieden, Arbeit und soziale Gerechtigkeit“. Der Grund für den Schritt sei der „katastrophale Kurs“ der Parteiführung um Janine Wissler und Martin Schirdewan, heißt es. Diese trage die „selbstzerstörerische Sanktionspolitik der Ampel“ mit, es seien sogar Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert worden.
Die Spaltung der Linken ist wenig überraschend. Seit Jahren liefern sich die Flügel Grabenkämpfe. Das spiegelt sowohl den Werdegang der SPD als auch den der Grünen wider. Verantwortlich dafür sind wohl zwei entscheidende Faktoren: erstens ihre Einbindung in staatliche und politische Institutionen und Strukturen, zweitens ihre Abkehr von der Klassenanalyse als Kernelement linker Politik.
Unterstützer der Machtverhältnisse
Zunächst einmal ist es entgegen zahlreicher Verlautbarungen sinnvoll und nicht sehr schwer, linke von rechter Politik zu unterscheiden. Links im politischen Sinne bedeutet, für die Gleichwertigkeit aller Menschen, demzufolge gegen Hierarchien, Machtausübung und Unterdrückung zu kämpfen. Rechte Politik steht indes für den Erhalt, die Übernahme oder gar die Ausweitung der bestehenden Herrschaft weniger über viele.
Die bürgerlichen Machtverhältnisse sind zunächst nicht ideologisch, sondern materiell begründet. Den einen gehören die Konzerne, Banken und Rohstoffe, die anderen müssen ihre Arbeitskraft an diese verkaufen. Das führt zu gegensätzlichen, unversöhnlichen Interessenkonflikten zwischen Kapital und Arbeit. Diese soll der Staat mit seinem politischen Überbau und seinen Institutionen managen.
Wer also die gegenwärtigen Machtverhältnisse unterstützt, handelt per definitionem rechts, egal, ob die AfD für strenge Hartz-IV-Sanktionen oder gegen eine Mietpreisbremse stimmt oder ob SPD, Grüne oder Linke einen autoritären Staat gegen Ungeimpfte oder Rüstungsexporte befürworten. Um einstmals Linke dazu zu bringen, rechte Politik zu betreiben, haben die Herrschenden sie eingebunden. Wie das gelang, zeigt ein Blick in die Geschichte.
Assimilation der Sozialdemokratie
Den Keynesianismus der drei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, genannt auch „Soziale Marktwirtschaft“ nach dem Modell von John Maynard Keynes, ermöglichte der notwendige Wiederaufbau. Dieser nämlich führte zu einer längeren Periode des rasanten Wirtschaftswachstums.
Die Politik band die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften ein, propagierte „Sozialpartnerschaft“ statt Klassenkampf, versüßte dies mit Zugeständnissen an die Arbeiter und zog auf diese Weise den Arbeiterorganisationen die Zähne.
Doch schon in den 1970er-Jahren nahm die Krisendynamik des real existierenden Kapitalismus im imperialistischen Zeitalter wieder zu. Die Arbeitslosigkeit wuchs, die Sozialdemokratie lag praktisch brach, und der moderne Neoliberalismus, fußend auf der antisozial-marktradikalen Ideologie unter anderem eines Friedrich August von Hayek, hielt Einzug.
Die Neoliberalisierung
Das erste Experimentierfeld der Neoliberalen war Chile. Nach dem Putsch 1973 gegen Präsident Salvador Allende setzte die Militärjunta unter Augusto Pinochet die „Marktreligion“ brutal durch, wenn auch nicht gänzlich um. Es folgten weitere neoliberale Umwälzungen, etwa mit Margaret Thatcher in Großbritannien und Ronald Reagan in den USA, in deren Folge wie in zuvor in Chile die Slums und Elendsviertel wuchsen.
Deutschland hielt dem ein wenig länger stand. Um die Jahrtausendwende begannen ausgerechnet die SPD und die Grünen in der Regierung – zur Freude von Union und FDP – mit dem neoliberalen Umbau unter dem Titel „Agenda 2010“: Deregulierung der Märkte, Privatisierung der öffentlichen Daseinsfürsorge, Abbau von Arbeiterrechten, Zusammenlegen von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu einem repressiven Sanktionsapparat mit dem ausdrücklichen Ziel, den Niedriglohnsektor auszuweiten, und so weiter.
Dem Neoliberalisierung von SPD und Grünen ging etwas Entscheidendes voraus: ihre materielle und strukturelle Einbindung in das bürgerliche System. Das war nicht schwer: Die Spitze der SPD rekrutiert sich schon seit Langem nicht mehr aus der Arbeiterklasse, sondern vor allem aus dem Bildungsbürgertum. Die Grünen indes waren zu keiner Zeit eine Arbeiterpartei, sondern entstammten bereits der Mittelklasse, die sich selbst nie als Vorhut des Proletariats sah.
Wie die Grünen hatte die heutige Linkspartei nie eine proletarische Basis. Im Osten ging sie als PDS aus der SED-Bürokratie hervor, die sich rasch dem neuen System anpasste. Auch ihr Zusammenschluss 2007 mit der WASG, die sich aus SPD-Abtrünnigen unter Oskar Lafontaine rekrutierte, brachte ihr keine nennenswerte Basis. Hatte man ganz zu Beginn in den 1990er-Jahren noch Reste von Klassenanalyse in der PDS vorfinden können, war es spätestens kurz nach der Jahrtausendwende damit vorbei.
Zwei marktradikale Fronten
Das politische Zwei-Parteien-Pingpong in den USA, wo noch vor wenigen Jahrzehnten jede ansatzweise soziale Idee als sozialistisches Teufelswerk galt und Linke aus öffentlichen Ämtern verbannt wurden, ist ein Paradebeispiel für die Assimilation des politischen Gegners. Republikaner und Demokraten werden zwar als rechte und linke Seite gepriesen, vertreten aber dennoch beide eine neoliberale Ideologie.
Die politischen Lager in den USA profitieren lediglich von unterschiedlichen Sponsoren. Man könnte es vielleicht so beschreiben: Hinter den Republikanern steht das alteingesessene Großkapital, also Öl und Kohle etwa, während das „grüne“ Kapital die Demokraten unterstützt. Just ihre marktradikalen Doktrinen vermarkten beide Seiten unterschiedlich: Die Republikaner beharren auf „konservativen Werten“, die Demokraten geben sich progressiv, weltoffen und eben „woke“.
Auch wenn mancher das nicht glauben mag: Marktradikaler Neoliberalismus kann durchaus autoritär und brutal gegen die Arbeiterklasse und sogar den Mittelstand durchgesetzt werden – Chile unter Pinochet ist dafür das beste Beispiel. Denn die viel gepredigte Freiheit gilt nur für die Märkte – oder besser: für die stärksten Marktteilnehmer. Der Konkurrenzkampf lässt grüßen.
Betrachtet man allein die technologische Entwicklung, kann man das „grüne“ Kapital durchaus als progressiv, also fortschrittlich bezeichnen. Im Westen erlangte es in den letzten Jahren immer mehr politische Macht, während die alten Kräfte ihre Felle davonschwimmen sehen. Unter dem Label „progressiv“ ist es dem grünen Kapital gelungen, einstmals linke Kräfte, nicht nur in den USA, an sich zu binden.
Anders gesagt: Auf der politischen Bühne des „Wertewestens“ findet ein machtpolitisches Gerangel zweier neoliberaler, imperialistischer Kapitalfraktionen und ihrer politischen Apparate statt. Die eine Seite repräsentiert das konservative Lager, der anderen ist es gelungen, mit progressiv erscheinendem, wokem Schönsprech und grünen Versprechen einstmals linke Kräfte hinter sich zu scharen.
Den politisch führenden Neoliberalen steht also eine neoliberale Opposition gegenüber. Besser kann es für die Herrschenden kaum laufen: Im Angebot ist Neoliberalismus in verschiedenen Verpackungen.
Woker Moralismus statt Klassenkampf
Nun ist es alles andere als links, sich hinter einer Herrschaftsfront zu versammeln, egal, unter welchem Label diese gerade firmiert. Dass dies gelingen konnte, hat einen Grund: die Abkehr vom Klassenkampf hin zum Glaube an den Reformismus, einhergehend mit einer tiefgreifenden Verbürgerlichung der Parteiführungen. Die ehemaligen Linken haben sich mit den Herrschaftsverhältnissen arrangiert. Sie vertreten schlicht nicht mehr die Interessen des Proletariats, sondern predigen den Klassenfrieden.
Doch dieser existiert nicht und kann auch gar nicht existieren. Sämtliche sozialen und Arbeitsrechte wurden historisch durch Widerstand von unten durchgesetzt, durch Streiks und Demonstrationen, kurz: Klassenkampf. Die neoliberale Ideologie hält aber nichts von solchen Rechten. In diesem Sinne schrumpft die Politik in Deutschland und anderswo seit Jahren den Sozialstaat – unabhängig von der jeweiligen Regierung. Denn neoliberal sind sie inzwischen alle.
Auch die Linkspartei hat dem Klassenkampf von oben so gut wie nichts entgegenzusetzen, nicht einmal mehr rhetorisch. Sie sieht weitgehend zu, wenn die Regierung unter dem Label der Alternativlosigkeit jede Wirtschaftskrise mit noch mehr Neoliberalisierung beantwortet. Bestenfalls wettert sie gegen vermeintliche, selten echte Nazis und ein wenig über soziale Ungerechtigkeit. Selbst das ist eigentlich nur eine Floskel, denn manch einer mag es als „sozial gerecht“ empfinden, Arme verhungern zu lassen.
Ihr Wettern verpackt die Linke in ganz viel Moralismus, dem jede materielle Analyse der Verhältnisse fehlt. Die Existenz von Arm und Reich hat nun einmal eine materielle Grundlage. Macht beruht auf wirtschaftlichen Eigentumsverhältnissen. Statt diese zu benennen, stümpert die Linke an der Oberfläche der Symptome herum, ja suhlt sich gemeinsam mit der grünen Kapitalfront und ihren „woken“ politischen Vertretern in einer bürgerlich-identitären Moralblase, die genau nichts an der Lage der Menschen ändert.
Mit der weitgehenden Aufgabe des Kampfes gegen die materielle Ungleichheit hat die Linke den Kern linker Politik ad acta gelegt. Um das zu verdeutlichen: Ein obdachloser Homosexueller leidet genauso wie ein obdachloser Heterosexueller. So ist das auch bei Schwarzen und Weißen, Frauen und Männern, Russen und Deutschen. Armut wird nicht erträglicher, wenn jeder sein Geschlecht beliebig ändern darf.
Kein Wunder, dass sich Arme von „linken“ Parteien, die in Wahrheit rechte Politik betreiben, verhöhnt fühlen. Immerhin verfügt die Hälfte der deutschen Bevölkerung über so gut wie kein Vermögen, wie eine Karte der Berliner Morgenpost zeigt. Diese Hälfte weiß genau: Durch Gender-Regeln oder Debatten darüber, ob Transfrauen künftig in Frauensaunen gehen dürfen sollen, wird für sie das Leben nicht besser.
Eine neue Arbeiterpartei?
Kurzum: Die ehemalige Linke hat mit der Arbeiterklasse nicht mehr viel am Hut. Mehr noch: Sie lässt sie im Regen stehen und sieht zu, wie Ultrarechte und Neoliberale sie auf den Straßen mit allerlei Versprechen abholen, um sie dann noch zu beschimpfen. Die ehemals Linken vergraulen somit ihre eigene ursprüngliche Zielgruppe – welch ein Freudenfest für alle Neoliberalen und sonstigen Ultrarechten dieses Landes.
Zumindest Letzteres hat die Gruppe um Wagenknecht offenbar erkannt. Auf ihre politischen Antworten darf man gespannt sein. Allzu große Hoffnungen auf eine neue klassenkämpferische Kraft braucht man sich wohl nicht zu machen. Viel eher könnte es auf eine sozialdemokratische Partei hinauslaufen, die bestenfalls der fortgesetzten Umverteilung von unten nach oben nicht stillschweigend zusieht. Aber das wäre allemal besser als nichts.
Quelle: RT DE
Hinweis: Gastbeiträge geben immer die Meinung des jeweiligen Autors wieder, nicht meine. Ich veröffentliche sie aber gerne, um eine vielfältigeres Bild zu geben. Die Leserinnen und Leser dieses Blogs sind auch in der Lage sich selbst ein Bild zu machen.