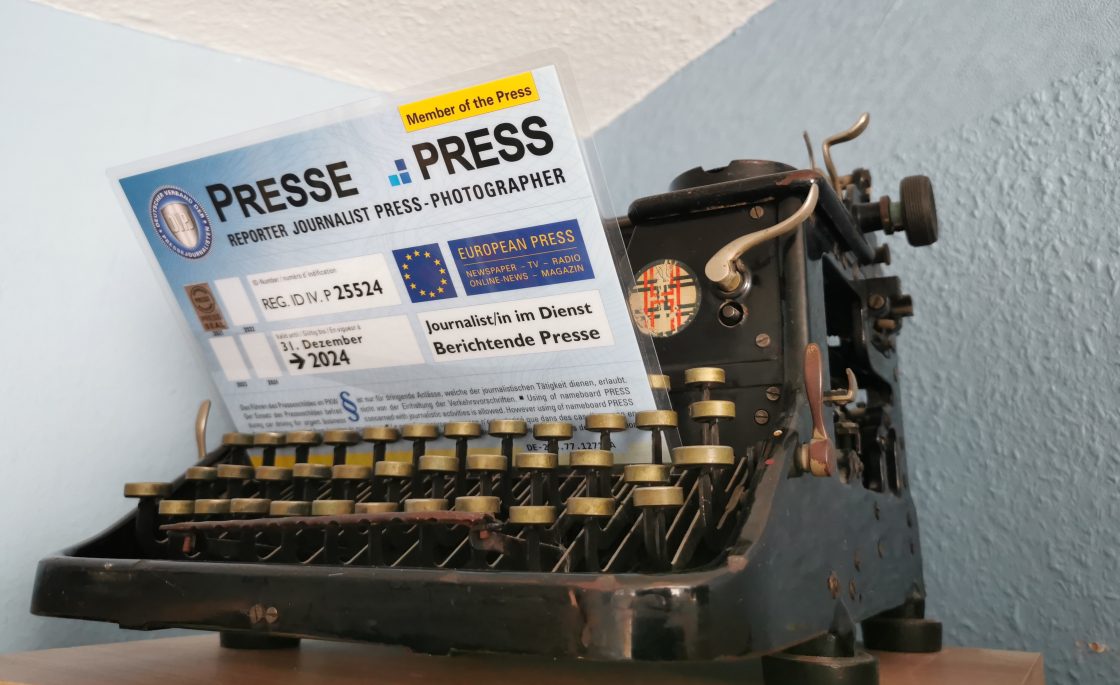Von links: Dr. Wilfried Kruse, Wiltrud Lichte-Spanger und Werner Nass. Foto: C. Stille
„Ein Paukenschlag ging vor 50 Jahren durch den Dortmunder Norden, der ganz Deutschland bewegte“, so Wiltrud Lichte-Spanger, die Vorsitzende des Evinger Geschichtsvereins. Spontane Streiks, ohne Unterstützung durch Gewerkschaften oder Parteien, begannen im September 1969 auf der Westfalenhütte, setzten sich über die Zentralwerkstatt der Zeche Fürst Hardenberg auf die Dortmunder Schachtanlagen und die Dortmunder Stadtwerke fort. Auch Betriebsräte hielten sich zurück, verschlossen sich in ihren Büros. Erfolge hefteten sie sich später an die Brust. Bald breitete sich die Streikwelle, der „Heiße Herbst 69“ über ganz Deutschland aus – Geschichte, die heute noch aktuell ist. Am Montagabend war dies Thema bei einer Veranstaltung des Evinger Geschichtsvereins. Als Zeitzeuge berichtete Werner Nass, später einer der einflussreichsten Betriebsräte in der Stahlindustrie, wie er den Streik erlebte.
Zur Situation im September 1969
Wiltrud Lichte-Spanger erinnerte an die Geschichte vor den Streiks. Zuvor hatte es nach dem Krieg in Westdeutschland die Aufbaujahre auch im Ruhrgebiet gegeben. Dann jedoch sei die erste Wirtschaftskrise 1966 eingetreten. Später sei eine Erholung erfolgt. Die Studentenbewegung stellte alles in Frage, was die Zeit des 2. Weltkriegs überlebt hatte. Auf dem Höhepunkt des Wirtschaftsbooms waren Gewerkschaften, wie sie meinten, durch die Friedenspflicht an langfristig abgeschlossene, niedrige Tarifverträge gebunden, während die Hoesch-Konzernleitung den Aktionären eine drastische Erhöhung der Dividenden ankündigte, sahen die Arbeiter weiter in die Röhre.
1969 sei dann die Forderung aufgestellt worden den Stahlarbeiter zwanzig Pfennig mehr pro Arbeitsstunde zu zahlen. Das wurde von den Verwaltungen brüsk angelehnt.
Wilfried Kruse: In den Jahren 1969 und folgende ging mit der Nachkriegszeit die Adenauer-Zeit zu Ende, die „grauenvoll war“
Dr. Wilfried Kruse, ehemals Leiter der Sozialforschungsstelle in Dortmund, gab den ZuhörerInnen einleitend einen Einblick in die „lange Vorgeschichte“ der Streiks. Wenn bezüglich der Septemberstreiks von 1969 von spontanen Streiks geredet werde, so Kruse, entstehe der Eindruck, sie seinen „plötzlich und aus heiteren Himmel“ gekommen. Was nicht der Fall gewesen sei. Es stimme weder gesellschaftlich noch betrieblich. Kruse sagte, er habe eigentlich ein kurzes Video aus der Deutschen Schlagerparade 1969 zeigen wollen. Dies war aber an technischen Problemen gescheitert. Der Titel der Veranstaltung lautete ja „September 1969: Als die heile Welt zerbrach“. Deshalb der Blick auf die Schlager jener Zeit: denn die heile Welt ging ja auch 1969 noch weiter, wusste Kruse. Zwar habe es Elvis und Woodstock in den USA und die Beatles in Großbritannien gegeben – in der BRD aber hatte ein Schlagerstar den größten Erfolg überhaupt im Lande. Das sei Heintje gewesen, der Inbegriff von heiler Welt, mit „Heidschi Bumbeidschi“ Anfang 1969 der größte Hit.
Er erzähle das, erklärte Kruse, weil wir uns davor hüten müssten, Schwarz-Weiß-Bilder zu erzeugen.
Es habe nämlich immer Widersprüche und Spannungen gegeben.
In den Jahren 1969 und folgende gehe es um das Ende der Nachkriegszeit. Präziser gesagt: „Das der Adenauer-Zeit.“ Eine Zeit in der es eine Kombination gegeben habe aus einem in den 1950er Jahren beginnenden sogenannten „Wirtschaftswunder“ (Sinnbild dafür war Ludwig Erhard mit der Zigarre im Mund) und gleichzeitig eine äußerst konservative Grundhaltung. Einerseits es sei eine Zeit voller Optimismus – nach dem Krieg ging es endlich wieder aufwärts – gewesen, die andererseits jedoch, was die gesellschaftlichen Verhältnisse betreffe, „grauenvoll war“.
Der Faschismus war beschwiegen worden
Nach 1945 sei der Faschismus eigentlich nicht zum Thema gemacht, sondern verdrängt und beschwiegen worden. Weshalb Dr. Kruse den Beginn des Endes der Nachkriegszeit nicht bei den 69er Streiks, sondern beim Auschwitz-Prozess (1963-1965) verortet.
Mit Willy Brandt kam ein Politik- und Moralwandel
Als wichtiges Datum nannte Wilfried Kruse 1966. Da sei nämlich die erste Garde der westdeutschen Politiker aus den 1950er Jahre abgelöst worden. Es kam zur ersten Großen Koalition. Der Sozialdemokrat Willy Brandt (im Widerstand gegen die Nazis tätig gewesen) wurde in der Bundesregierung des Christdemokraten Kurt-Georg Kiesinger (einem Nazitäter) Vizekanzler. Willy Brandts Credo: „Mehr Demokratie wagen“. Bei der Bundestagswahl am 28. September 1969 – wenige Tage nach dem Septemberstreik – bekam die SPD knapp 42 (!) Prozent der Stimmen. Willy Brandt wurde Bundeskanzler der sozial-liberalen Koalition (mit der FDP). Es habe ein Kultur- und Moralwandel begonnen und ein verändertes Frauenbild gegeben. Was Willy Brandts Politikwandel ermöglichte.
Für den jungen Gewerkschafter Werner Nass war diese Zeit „ein Hammer“
Nachdem Dr. Wilfried Kruse zum besseren Verstehen den entsprechende gesellschaftlichen Hintergrund jener Zeit nachgezeichnet hatte, sprach Zeitzeuge Werner Nass darüber wie es zu den Septemberstreiks gekommen war. Er selbst erlebte sie als junger Vertrauensmann „im dritten und vierten Glied“. Diese Zeit, sagte Nass, sei damals „ein Hammer für einen jungen Gewerkschafter“ gewesen.
An diesem 2. September 1969 habe er zufällig Frühschicht im Walzberg als Schweißer gehabt: „Um neun Uhr ging das dann rund.“
Die Konjunktur brummte: Für Aktionäre hohe Dividenden. „Die Malocher sollten außen vor bleiben“
Mehrere Faktoren wären damals zusammengekommen. 1969 sei genauso ein heißer Sommer wie 2018 gewesen. Da habe der Vorstand gesagt, man müsse den Kollegen an den Hochöfen etc. wenigstens eine Flasche Wasser geben. Das Unternehmen habe horrende Gewinne gemacht, die Konjunktur war enorm nach oben gegangen. Die Aktionäre sollten höhere Dividenden bekommen. Nass: „Aber der Malocher sollte außen vor bleiben.“
Dann spielte die IG-Metall eine Rolle. Was vor fünfzig Jahren so war und heute noch so ist. Die Perspektive sei, stets Tarifverträge für 12 Monate abzuschließen. Was ganz selten eingehalten worden sei und längere Laufzeiten vereinbart wurden. 1969 brummte also die Konjunktur und der Tarifvertrag lief noch bis zum 1. Dezember dieses Jahres. Einen neuen Tarifvertrag zu verhandeln war nicht möglich. Die IG Metall habe gesagt: Uns sind die Hände gebunden.
Zwischen den drei Stahlstandorten in Dortmund habe es seinerzeit Stundenlöhne zwischen 5,30 DM und 5,40 DM gegeben, während in der Weiterverarbeitung die Löhne höher gewesen seien.
Die Vorstände lehnten die Forderungen des Betriebsrats ab
Die Betriebsratsvorsitzenden gingen damals daran am 15. August 1969 Forderungen zu stellen, die Tarifverhandlungen vorzuziehen und der Arbeitslohn pro Stunde sollte um 20 Pfennig rückwirkend steigen.
Die Betriebsdirektoren äußerten Verständnis. Die Vorstände aber lehnten ab. Die Vorstände von Union und Phoenix waren bereit am 1. Dezember 1969 fünfzehn Pfennige draufzulegen. Der Betriebsrat der Westfalenhütte lehnte einstimmig dieses Angebot ab. Man wollte 20 Pfennig mehr, sofort.
Um den Forderungen Ausdruck zu verleihen, sollten 100 Arbeiter auf die Treppe zur Hauptverwaltung kommen – doch schon bald waren es 1000 und dann fast 3000!
Der damalige Betriebsrat Albert Pfeifer habe dann im Gespräch mit dem damaligen Vorsitzenden der Vertrauenskörperleitung Fritz Wäscher gebeten,

Treppe zur Hoesch-Verwaltung in späteren Jahren. Foto: via Geschichtsverein Eving.
dass dieser 100 Kollegen bitte, auf die Treppe zur Hauptverwaltung zu kommen. Nun rumorte es überall in den Betrieben. Einige Vertrauensleute im Bereich des Hochofens wollten es aber nicht bei der Zahl von 100 Kollegen belassen. Sie wollten die Kaffeepause um 9 Uhr nutzen, um mit mehr Leuten zur Hauptverwaltung zu kommen. Werner Nass: „Man ist gestartet und wusste nicht wo man landet.“
Auf einmal waren 1000 Menschen vor der Hauptverwaltung. Der Betriebsrat begannt mit dem Vorstand Gespräche zu führen. Der Vorstand sagte 20 Pfennig mehr zu. Doch zwischenzeitlich war die gesamte Frühschicht – vielleicht fast 3000 Arbeiter an der Treppe. Bevor das Ergebnis von 20 Pfennig mehr bekannt wurde, wurde die Losung herausgegeben: 30 Pfennig mehr. Die Sache schaukelte sich hoch. All das kam von der Basis. Die IG Metall, so Nass, und der Betriebsrat waren außen vor. Der Betriebsrat lehnte ab weitere Gespräche zu führen. Nun forderte man – wenn heute nicht 30 Pfennig beschlossen würden – fordere man 50 Pfennige. Eine Strohpuppe wurde symbolisch an der Hoesch-Hauptverwaltung aufgehangen.
Was wiederum dazu führte, dass die bürgerliche Presse – etwa die FAZ und die Bildzeitung – schrieben, die Frau des Vorstandsvorsitzenden Fritz Harders hätte sich auf ihrem Grundstück in Ergste mit der Pistole verteidigen müssen gegen diese schlimmen Stahlarbeiter. Diese seien von Kommunisten oder was auch immer ferngesteuert. Nass: „Alles erlogen.“ Er machte deutlich, an diesem 2. und 3. September 1969 habe es keinerlei parteipolitischen Aktivitäten gegeben. „Es waren die normale Kumpel, die Vertrauensleute, die aus eigenem Antrieb handelten.
Solidarität von den anderen Werken in Dortmund: 20 000 Menschen trafen sich am Wall!
All dies habe sich mittags am 2. September abgespielt. Studenten hätten versucht die Macht zu übernehmen. Die Stahlarbeiter rochen jedoch Lunte und ließen sich nicht missbrauchen.
Die Westfalenhütte stand alleine da. Die beiden anderen Werke in Dortmund sollten davon abgehalten werden sich zu solidarisieren. Die Mittagsschicht der Westfalenhütte führte den Streik weiter. Bei Union und bei Phoenix ließ nun ebenfalls die Nachtschicht die Arbeit ruhen. Der Betriebsrat forderte die Arbeiter auf die Arbeit wieder aufzunehmen
. „Ein ganz gefährliche Sache“, merkte Werner Nass an: „Uneinigkeit auf der Arbeitnehmerseite.“ Der Vorstand war dennoch nicht bereit zu verhandeln. Man glaubte – auch weil die IG Metall außen vor – die Sache liefe sich tot.

Am Hoesch-Museum. Foto: Stille
Am zweiten Tag des Streiks, dem 3. September, kam von den beiden anderen Werken in Dortmund das Signal an die Arbeiter der Westfalenhütte: Wir kommen zu euch.
Die Arbeiter von der Westfalenhütten kamen ihnen entgegen. Werner Nass: „Dieses Bild habe ich immer noch im Kopf. Das war der erste Kampf mit zwanzigtausend, die sich in der Stadt getroffen haben. Da war auch der kleine Krämer dabei, der ja auch Sorgen hatte, wenn das schief geht.“
Zwanzigtausend Menschen trafen sich am Wall.
„Es war eine Stimmung, getragen von der Kraft, die von unten kam“, erinnerte sich Nass. Doch keiner habe gewusst wie und wo es enden werde.
Sieg! „So ein Tag so wunderschön wie heute“
Gegen elf Uhr an diesem Tag war der Vorstand wieder bereit, die Verhandlungen aufzunehmen.
Wohl um zwanzig vor eins sei es gewesen, das Vorstand und Betriebsräte verkündet habe, die 30 Pfennig werden bezahlt, die Ausfallzeiten vergütet und es wird in keiner Form Abmahnungen geben.
Nass: „Unterm Strich ein unglaublicher Erfolg. Praktisch gegen die Gewerkschaft. Der Betriebsrat war stellenweise außen vor.“ Zum Schluss sei das Lied „So ein Tag so wunderschön wie heute.“ Noch am selben Tag wurde die Arbeit wieder aufgenommen.
Für ihn als junger Gewerkschafter, sagte Werner Nass, sei das ein Schlüsselerlebnis gewesen.
Er gab auch zu bedenken, dass man nach diesem unglaublichen Erfolg in nachfolgenden Arbeitskämpfen auch habe Niederlagen einstecken müssen. Erfolge setzten sich nicht einfach fort.
Werner Nass gab darüber hinaus zu bedenken, wenn man in einen Streik gehe, muss man auch sehen, wo eine Tür ist wo man wieder zurückkann. Auf der Gewerkschaftsschule habe man gelernt quer zu denken. Und entsprechendes Rüstzeug dafür erhalten, das Wirtschaftssystem zu begreifen. Mit den 69er Tagen habe ein neues Denken eingesetzt.
Die Septemberstreiks waren eine Initialzündung
Dr. Wilfried Kruse schätzte ein, dass der Septemberstreik auf der Westfalenhütte eine Initialzündung war, der fast die gesamte westdeutsche Stahlindustrie und 150 000 Stahlarbeiter erfasste. 30 000 Beschäftigte hatte sich in Dortmund am Septemberstreik in der Stahlindustrie und bis zu achttausend im Bergbau beteiligt.
Der Streik im Bergbau war ein Misserfolg
Im Bergbau indes sei die Streiksituation anders und viel schwieriger gewesen, erklärte Wilfried Kruse. Dort sei es um Arbeitskleidung und mehr Urlaub

Eingang ehemalige Zeche Minister Stein. Foto: via Geschichtsverein Eving.
gegangen. Die Vorstände im Bergbau hätten Verhandlungen abgelehnt. Die IG Bergbau und Energie war nicht nur wie im Stahlbereich die IG Metall außen vor, überrumpelt und nicht handlungsfähig, sondern massiv gegen diesen Streik eingestellt gewesen. Streikführer im Bergbau wurden von ihrer Gewerkschaft hart angegriffen.
Der Streik im Bergbau brach aus diesen Gründen zusammen und war ein Misserfolg.
Wolfgang Skorvanek sieht bei allen Unterschiedlichkeiten Gemeinsamkeiten zwischen den Septemberstreiks und der Klimaschutzbewegung
In der Einladung zur Veranstaltung war vermerkt: „Bei allen Unterschiedlichkeiten meint Wolfgang Skorvanek, ebenfalls stellvertretender Vorsitzender des Evinger Geschichtsvereins, gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Septemberstreiks von 1969 und der heutigen Klimaschutzbewegung um Greta Thunberg. Skorvanek: „Damals wie heute entstand eine spontane Aktion junger Menschen, die ohne Rücksicht auf Sanktionen neue Ansprüche formulierten, bevor sie von Institutionen wie Parteien und Gewerkschaften zunächst erkannt wurden.“
Fazit von Dr. Kruse
„Die Septemberstreiks waren der Höhepunkt, wo Arbeiter sichtbar wurden, aber gleichzeitig der Beginn vom Ende des Malochers. Des Malochers als schwer arbeitenden Bergarbeiter oder Stahlarbeiter.“
So könne man die Septemberstreiks als Höhepunkt und Abgesang des Malochers markieren.
Ein Kurzfilm zum Septemberstreik: