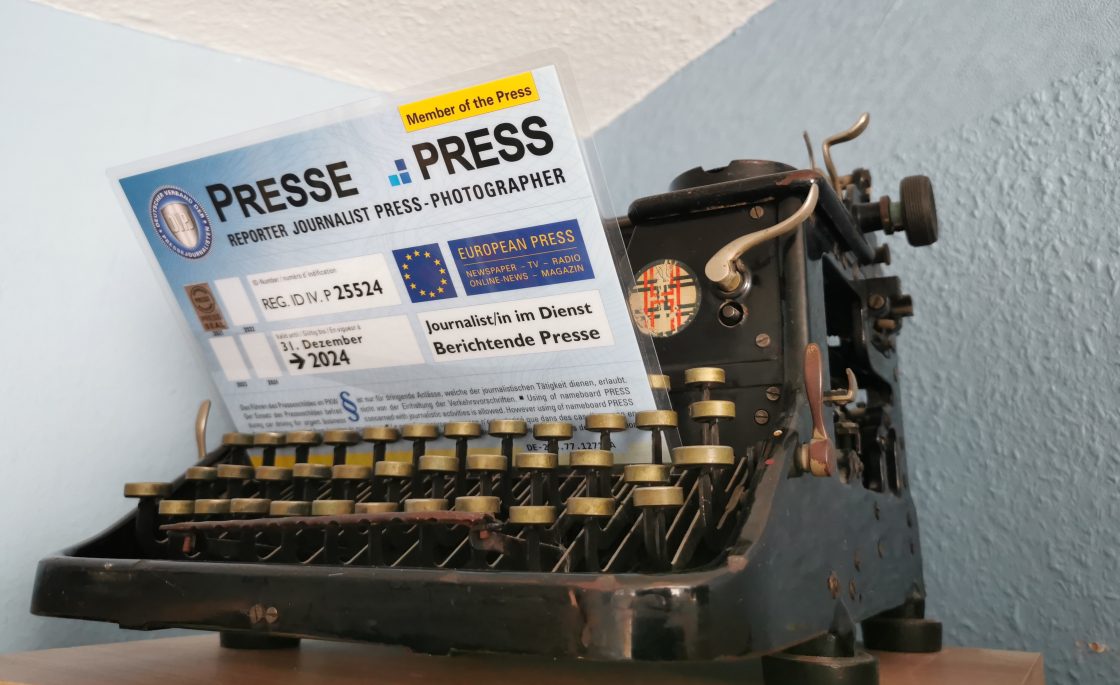Die aktuellen Kriege, die Hochrüstung und Eskalationsgefahren waren Thema von Teilen der Friedensbewegung am vergangenen Sonnabend in Essen. Die Tagung stand unter dem Titel „Friedensperspektiven statt Kriegsplanung“ und fand in den Räumlichkeiten der Volkshochschule Essen sowie im DGB-Haus statt.
Der Hintergrund
Knapp zwei Wochen vor der Tagung hochrangiger NATO-Militärs und Politiker (JAPCC Conference 2019) unter Beteiligung von Militärstrategen und der Rüstungsindustrie in der Messe Essen informieren ExpertInnen der Friedensbewegung auf der Friedenstagung über den Zusammenhang von Aufrüstung und Kriegsgefahr sowie über Möglichkeiten der Abrüstung und der Entspannung. Auch neue Konfliktgefahren als Folge des Klimawandels und der Eskalationsstrategie sind Thema.
Mit Vorträgen, Diskussionen, Workshops berieten sich Friedensaktivisten, was sie gemeinsam mit Aktivisten aus der Klimaschutz- und anderen Bewegungen tun können, um gegen Kriegsursachen aktiv zu werden, bestehende Konflikte zu deeskalieren und um einen Ausstieg aus der Rüstungsspirale zu erreichen.
Die Aufklärung über die Propaganda der Militärs, deren Strategieentwicklung auf den Essener NATO-Konferenzen, die Gefahr eines nuklearen Infernos und über die Verantwortung und Möglichkeiten der Friedensbewegung ist Ausgangspunkt für die nächsten Aufgaben und Schritte der Kräfte des Frieden standen auf der Tagesordnung mehrerer Workshops.
Schirmherr der Tagung war Konstantin Wecker. Er sandte ein Grußwort an die zahlreich erschienenen Tagungsteilnehmer aus nah und fern.
Eröffnungsplenum mit zwei Gästen
Nach Begrüßung der

Von links: Reiner Braun und Kathrin Vogler.
Tagungsteilnehmer und einer Einleitung seitens Joachim Schramm (Geschäftsführer DFG-VK-NRW) startete das Eröffnungsplenum mit Kathrin Vogler (MdB DIE LINKE) und Reiner Braun (Co-Präsident International Peace Bureau). Das Thema: „70 Jahre Nato –
Kalter Krieg, Weltpolizeianspruch und Eskalationsgefahr“.
Reiner Braun: Nato ist seit Gründung Aggressionsbündnis
Reiner Braun unternahm einen historischen Rückblick auf die 1949 von 12 Ländern gegründete Nato (1950 kam Westdeutschland, die Alt-BRD hinzu), welchen er mit aktuellen Fragestellungen der Zeit verband. Heute sind 30 Länder Mitglied in der Nato. Der Counterpart, so Braun, die Sowjetunion, ist nicht mehr da. Doch die Nato habe sich dennoch gen Osten ausgeweitet. Heute sei die Nato kein Nordatlantisches Militärbündnis mehr, das vielleicht noch für Zeit bis 1990 gestimmt habe. Braun: „Die Nato ist das Militärbündnis dieser Welt zur Sicherung von Ressourcen und Profiten.“ Es sei u.a. selbst mit Kolumbien, einem Bürgerkriegsland verbunden, wo Nato-Übungen stattfänden. Selbst mit Brasilien, dem größten Land Lateinamerikas buhlten der Faschist ((Bolsanaro) und die Nato um eine Zusammenarbeit.
Der entscheidende Erweiterungshorizont sei Asien. Es ginge fraglos dabei um den zweiten Hauptfeind der Nato, China, das eingekreist werden solle.
Dies werfe die Frage auf: „Ist eigentlich dieses Bündnis immer noch, oder war es jemals ein Verteidigungsbündnis?“ Er würde gerne behaupten, so Braun, dass die Nato schon seit ihrer Existenz ein Aggressionsbündnis war. Es sei immer gegen die Ergebnislage des Zweiten Weltkriegs vorgegangen.
Von Anfang an habe die Nato dazu gedient, die Sowjetunion wieder zu einem Russland zurückzudrängen. Auch, indem man die Länder des Ostblocks zu „befreien“ vorgab. Die Nato habe aktiv daran gearbeitet das die Linksregierungen in Frankreich und Italien beendet wurden. Auch habe die Nato in den 1950er und 1960er Jahren eine aggressive Atomwaffenstrategie (mit dem Ziel eines Ersteinsatzes (!) von Atomwaffen) verfolgt. Eine Nato-Direktive habe sogar den Titel „Atombombenziel Sowjetunion“ getragen. Eingezeichnet gewesen seien da auf einer Karte die 200 größten Städte und Orte der UdSSR. Der Vorwurf seitens der Nato betreffs einer atomaren Vorrüstung der Sowjetunion sei stets eine Lüge gewesen. Immer habe Moskau auf westliche Vorrüstung reagiert und nachgerüstet.
Nach 1990, so Reiner Braun, habe die Nato sehr schnell darauf gesetzt, das Feinbild Russland wiederzubeleben. Braun: „Heute geht es der Nato eindeutig darum Russland einzuzirkeln und einzugrenzen und China einzuzirkeln und einzugrenzen.“ Es gehe um nichts anderes als um eine westliche Dominanz in einer veränderten Welt zu bewahren. Das sei gefährlich, da sie zu einer Eskalationsspirale führe, zu der auch ein faktisch vertragsloser Zustand zwischen den großen Mächten gehöre. Das berge eine große Kriegsgefahr – sogar Atomkriegsgefahr – in sich. Dringend nötig sei ein Zurück zu „einer kooperativen Sicherheit, zu einer Politik der gemeinsamen Sicherheit, zu Abrüstung.“
Kathrin Vogler: Vogler: Wer Frieden wolle, muss „diese aggressive Nato“ überwinden
Die Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler erinnerte an einen Vorschlag des einstigen Nato-Generalsekretärs Manfred Wörner, der im Mai 1990 vom Aufbau einer neuen europäischen Sicherheitsstruktur, die die Sowjetunion und die Staaten des Warschauer Paktes umfassen sollte, gesprochen habe.
Damals sei auch Wörner davon ausgegangen, dass das (leider Gorbatschow nicht schriftlich) gegebene Versprechen, die Nato würde sich nicht über die damalige „kleine“ BRD hin gen Sowjetunion ausbreiten, gelte. Der Status quo sehe heute bekanntlich ganz anders aus: „Die anfängliche Euphorie verflog, der Drang nach Osten blieb.“
Vogler steht heute auf dem Standpunkt, dass eine angenommen statt gehabte Einbeziehung Russlands in die Nato nicht zu einer Entspannung beigetragen hätte. Zu sehr sei das westliche Interesse an einer Kontrolle Russlands (und seiner Bodenschätze). Auch wäre das heute eine „unheimliche Provokation“ des aufstrebenden Chinas. Vogler: Wer Frieden wolle, müsse „diese aggressive Nato“ überwinden. Andere internationale Institutionen müssten genutzt werden, um Sicherheit in Europa zu garantieren. Der Nato nämlich wohne von Grund auf eine strukturelle Gewalt in der Interpretation des Friedensforschers Johan Galtung inne. Des Weiteren würden Wirtschaft und Militär als zwei Seiten einer Medaille eingesetzt.
Reinhard Lauterbach: „Die Nato war von Anfang an ein Bündnis, das auf den Rollback ausgerichtet war“
Sehr aufschlussreich an diesem Sonnabend war der Vortag zum Thema „Nato und Russland – Konfrontation oder Koexistenz“ des Journalisten Reinhard Lauterbach (junge Welt, Ex-ARD-Journalist), eines ausgewiesenen Osteuropa- und Russland-Kenners.
Lauterbach brachte eingangs seines hochinteressanten Referats einen Ausspruch des ersten Nato-Generalsekretärs Lord Hastings Ismay in Erinnerung wonach nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs danach zu streben sei, die Amerikaner drin, Deutschen niederzuhalten und die Russen draußen zu halten. Die Nato habe von vornherein eine Stoßrichtung gegen Russland verfolgt, sagte Lauterbach.
Mit der keineswegs realistischen Annahme, die Russen (mit Bezug auf vom Westen fehlinterpretierten Äußerungen von Stalins) wollten (nach Europa) hinein. Lauterbach: „Die Nato war von Anfang an ein Bündnis, das auf den Rollback ausgerichtet war.“
Dieser sei aber jedoch durch eine militärischen Aufholprozess der Sowjetunion etwa durch die waffentechnische Überlegenheit relativiert und besonders durch die Brechung es amerikanischen Atomwaffenmonopols 1949 erschwert worden.
Ab 1989 seien die Hoffnungen auf diesen Rollback wieder genährt worden. Und eine Ausweitung schon 1988 in den USA erwogen worden, bevor es den Machtwechsel in 1989 Polen hin zur Solidarnosc gegeben habe. Dadurch sei die DDR quasi zu „einem überreifen Apfel“ geworden. Die DDR sei dann schließlich meistbietend sozusagen an die BRD verschenkt worden.
Im Winter 1989/90 habe Helmut Kohl seinem „Strickjackenkumpel“ Michail Gorbatschow zugesichert, dass die Nato an die Sowjetunion hinan rücke. Gorbatschow habe damals allerdings nicht die Klugheit besessen, sich das schriftlich geben zu lassen. Kohl habe erwogen, Gorbatschow das schriftlich zu geben. Doch der damalige US-Präsident Bush der Ältere aber sei Kohl über den Mund gefahren und gesagt: Es könne doch wohl nicht sein, dass man der Sowjetunion erlaube im letzten Moment den Hals aus der Schlinge zu ziehen und ihre geostrategische Niederlage doch noch zu vermeiden.
Im Aufteilungskrieg Jugoslawiens habe sich die BRD insoweit eingemischt, indem sie Slowenien und Kroatien als selbstständige Staaten anerkannte. Sie habe diese Abspaltungen großzügig mit Militärgerät aus NVA-Beständen ausgestattet. Die Russen hätten dem hilflos zusehen müssen. Die Bombardierung Restjugoslawiens war der traurige Höhepunkt. Daraus u.a. resultiere eine Enttäuschung Moskaus, die bis heute fortdauere, meinte Lauterbach.
Aus diesen und andere Gründen hält Reinhard Lauterbach eine Annäherung Russlands an die Nato für äußerst unwahrscheinlich. Was ja ohnehin einen Teil der Gründungsintension der Nato (die Russen draußen zu halten) zuwiderlaufe. Auch dächte Moskau nicht daran sich den USA unterzuordnen.
Resultierend aus vielen Enttäuschungen, so Lauterbach, zeige Russland dem Westen (in Form von neuen Waffensystemen) inzwischen die Zähne, um den Westen vor unüberlegten Aktionen zu warnen.
Lauterbach ist sich sicher: die Nato ist derzeit von ihrer derzeitigen Konzeption nicht fähig mit Russland zu kooperieren. Die Nato ist und bleibe eben ein Konfrontationsbündnis.
Das Engagement der Nato in den baltischen Ländern nannte Reiner Lauterbach eine „ständige Provokation“. Ein Interesse Russlands auf das Baltikum zuzugreifen sieht der Journalist nicht.
Ein Kooperation zwischen der Nato und Russland sei an zwei Bedingungen geknüpft. Erstens käme da die hypothetische Annahme, dass deren Priorität Chinas gelte und Russland als den weniger gefährlichen Gegner einstufe, um Russland entgegenzukommen. Dies setze aber voraus, dass Russland in diese Falle hineintappe. Ein solches Szenerio sei zweitens unwahrscheinlich und langfristig nicht wirklich erfreulich. Eine alte Parole aus den 1980er gewönne wieder an Aktualität: „Kein Frieden mit der Nato“.
Andrej Hunko über die EU-Militarisierung und die Zurichtung der EU zu einem „imperialen Akteur“
Andrej Hunko (MdB DIE LINKE) befasste sich mit dem Thema „EU-Militarisierung – Konkurrenz oder Partner der Nato?“
Mit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages sei zum ersten Mal in einigen Artikels dieses Vertrages, stieg Hunko in sein Referat ein, sozusagen die Perspektive einer EU-Militarisierung aufgemacht worden. Schließlich im September 2017 sei bereits im Lissabon-Vertrag erwähnte , kurz PESCO ((Permanent Structured Cooperation, deutsch: Ständige Strukturierte Zusammenarbeit) – heißt: bestimmte Staaten können ohne die anderen (vor allem auf den Militärbereich militärisch bezogen) voranschreitend zusammenarbeiten – aus der Taufe gehoben. Dazu gehöre auch die Entwicklung einer Euro-Kampfdrohne. Die Bundesregierung hat einen Leasingvertrag mit Israel zur Entwicklung einer Heron-Kampfdrohne geschlossen.
Hunko skandalisierte die kürzlich im Zusammenhang mit dem Drohnenangriff auf eine Ölanlage in Saudi Arabien die kürzlich von der Bundesregierung zusammen mit Großbritannien und Frankreich verkündete „uneingeschränkte Solidarität“ mit Saudi Arabien als „unfassbar“ und „erschreckend“. Vor allem deshalb, weil die Begründung (Iran sei für den Angriff verantwortlich) dafür „kein Bezirksgericht“ anerkennen würde.
Ein weiterer Skandal: Im EU-Haushalt sind Mittel vorgesehen, die für Militärisches eingesetzt werden sollen. Was eigentlich verboten ist, werde durch einen Trick gelöst: Dass 13 Milliarden Euro dort für einen sogenannten Verteidigungsfonds eingestellt sind, die unter „EU-Förderung“ (Industrieförderung) rubriziert sind. DIE LINKE findet das strittig und wird als Bundestagsfraktion, vertreten vom Völkerrechtler Andreas Fischer-Lescano, gegen diesen „Verteidigungsfonds“ klagen. Allerdings muss erst der EU-Haushalt beschlossen dann im Amtsblatt der EU veröffentlicht sein.
Andrej Hunko fürchtet, dass die EU immer mehr zu einem, wie er es nennt, zu einem „imperialen Akteur“, aufgebaut wird. Obwohl eine reale Bedrohung Europas etwa durch Russland oder den Iran nicht zu erkennen sei.
Warum „imperialer Akteur“? Hunko: Ein „imperialer Akteur“ unterwirft sich keinen internationalen Vereinbarungen (etwa dem Völkerrecht) – wie ja an der USA zu sehen sei. In allen Dokumenten der EU werde wohl Bezug auf die UNO genommen, dass aber die Formulierungen immer lauten: Man teile die Ziele oder den Geist der UNO usw.
Das sei selbst in der BRD zu konstatieren. Vor allem seitens von Außenminister Heiko Maas kaum vom Völkerrecht gesprochen werde, sondern stattdessen verwende man zunehmend einen Begriff, der sich „regelbasierte Ordnung“ nenne.
Auch gehe die ganze EU-Erweiterungspolitik Hand in Hand mit der Nato. Mal habe die EU die Nase, mal die Nato die Nase vorn.
Abschlussplenum
Der Journalist, UNO-Experte mit langjähriger Erfahrung, Andreas Zumach (Genf) nannte dort nannte fünf Herausforderungen: Das Ende des Kalten Krieges und der Blockaufteilung der Welt. Den sogenannten islamistischen Terrorismus und den darauffolgende global geführten sogenannten „Krieg gegen die Terrorismus“ unter Führung der USA mit all seinen schwerwiegenden Völkerrechtsbrüchen und innenpolitischen Verschärfungen. Den relativen Machtabstieg der USA, der seit dem Anfang der 1990er Jahre zu beobachten sei und sich seitdem beschleunigt hat. Und mit China der Aufstieg einer künftigen neuen Weltmacht. Und in diesem Zusammenhang die Forderungen politischer Parteien – außer der Linkspartei -, dass die EU nun auch ein globaler Player sein müsse. Wozu auch alle militärischen Instrumente gehören müssten. Dazu gehöre ein teilweises Konkurrenzverhalten zu den USA. Und die globale Erwärmung. Das schaffe neue Aufgaben für die Friedensbewegung.
Zumach warnte allerdings vor dem nicht selten gebrauchten (Ohnmachts-)Begriff der „neuen Unübersichtlichkeit“ – was ja wohl heißen solle: Man kann nichts mehr machen. Was nicht stimme. Denn alles könne durchaus klar benannt mit entwickelten Antworten bearbeitet werden.
Neue Abrüstungskonferenzen sollten seiner Meinung unter dem Dach der UNO in Genf ausgehandelt werden. Darauf müsse die Friedensbewegung auch die Bundesregierung drängen. Zumach warnte nachdrücklich vor einem möglichen Krieg mit dem Iran.
Der Friedensbewegung schlug er dringend vor, zu fordern, ein Verbot von Atomwaffenbesitz ins Grundgesetz zu schreiben. Schließlich gebe es ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, das kommt nämlich zu dem Schluss, dass eine Beteiligung an Atomwaffenarsenalen andere Länder Deutschland nicht verboten sei.
Michael Müller, Bundesvorsitzender der Naturfreunde, ging auf die Kriegsgefahren in der Zukunft ein. Es stelle sich nämlich die Frage der „ökologischen Selbstvernichtung der Menschheit“. Damit würden Konflikte und Gewalt ausgelöst, die heute schon schwer vorhersehbar seien. Wenn die Klimaveränderungen etwa in 30 bis 40 Jahren da sind, seien diese „nicht mehr veränderbar“. Müller: „Wir müssen heute handeln, um morgen Kriege zu verhindern.“ Dies sehe er nirgendwo auf der Welt im Moment.
Die Auswirkungen des Klimawandels, gab Müller zu bedenken, betreffen am meisten die, welche ihn am wenigsten verursachen.
Es gehe nicht allein um die Klimafrage. Vielmehr gehe es um einen Endpunkt einer bestimmten Form wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung.
Michael Müller: „Friedenspolitik muss heute wesentlich weiter als nur die Frage der Abrüstung und der Rüstungskontrolle gefasst werden.“
Die Friedensfrage werde zu einem zutiefst gesellschaftlichen Thema. Mit der Überwindung sozialer Spaltungen und dem Versuch eine globale Umweltkompatibilität zu erreichen. Müller: „Sonst legen wir heute die Wurzeln für Kriege in der Zukunft, deren Tragweite wir gar nicht überschauen können.“
Prof. Peter Brandt (Initiative „Neue Entspannungspolitik jetzt!“) erinnerte daran, dass durchaus an ein neues Sicherheitskonzept für alle Staaten gedacht worden sei. Zuletzt auch 1990 („Charta von Paris“. Stattdessen habe die Nato sich ausgeweitet. Brandt: „Russland befindet sich heute in einen
territorialen Status wie im 17. Jahrhundert.“ Er gab zu bedenken, dass die Grundlage von Entspannungspolitik mal gewesen sei, sich in den anderen hineinzuversetzen.
Peter Brandt dachte einen „realistischen Pazifismus“ (betreffs einer „defensiven Territorialverteidigung“ der EU) an. Das wiederum kritisierte Andreas Zumach: Setze das nicht einen konkreten Feind, eine potentielle Bedrohung voraus? Brandt betrachte seinen Vorschlag aber als Vorläufer einer europäischen Sicherheitsarchitektur.
Die Kampagne „Abrüsten statt Aufrüsten“, regte Michael Müller an, solle ergänzt werden. Und zwar in der Form, dass das Geld was für die Aufrüstung im Bundeshaushalt geplant ist, für den Klimaschutz ausgegeben wird. Es werde überlegt, im nächsten Jahr einen gemeinsamen der Kirchen, der Friedensbewegung, der Umweltbewegung und Gewerkschaften zu machen – zu Thema Arbeit, Frieden, Klima. Damit solle auf den Zusammenhang dieser Themen aufmerksam gemacht werden. Es komme auf eine breite Basis an: „Sonst haben wir alle keine Chance.“
Moderator Bernhard Trautvetter (Essener Friedensforum) kündigte nach dieser interessanten Tagung an, eine „Essener Erklärung“ auszuarbeiten.