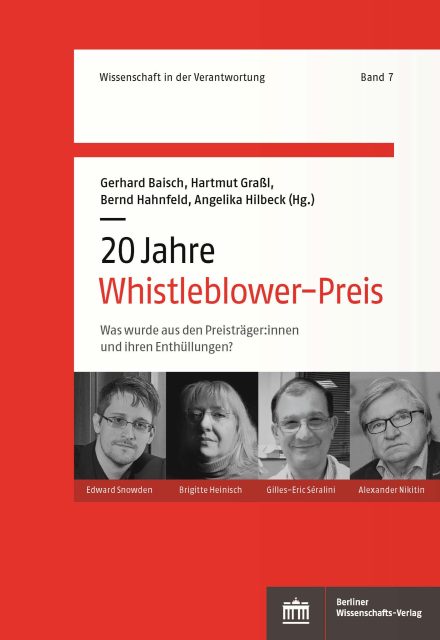PRESSEMITTEILUNG
Westend Verlag setzt sich im Fall Guérot für die Wissenschaftsfreiheit ein
„Da aber sah ich, dass den meisten die Wissenschaft nur etwas ist, insofern sie davon leben, und dass sie sogar den Irrtum vergöttern, wenn sie davon ihre Existenz haben.“
Goethe zu Eckermann, 15. Oktober 1825
Berlin, 13. November 2025.
Der Westend Verlag, der die letzten vier Bücher von Prof. Dr. Ulrike Guérot verlegt hat, nimmt zur Kündigungsschutzklage unserer Autorin gegen die Universität Bonn heute in folgender Pressemitteilung Stellung. Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit als Grundlage von Publizistik und Verlagswesen liegen uns dabei besonders am Herzen.
Nach Auffassung zahlreicher Juristen sind die Urteile des Arbeitsgerichts Bonn (24. April 2024) und des Landesarbeitsgerichts Köln (30. September 2025) rechtlich angreifbar. Frau Prof. Dr. Guérot und ihre Rechtsanwälte Tobias Gall (Berlin) und Christian auf der Heiden (Karlsruhe) sehen sich daher veranlasst, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts überprüfen zu lassen. Gegen das Urteil wurde eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesarbeitsgericht eingelegt. Dabei geht es Frau Prof. Dr. Guérot vor allem darum, den Vorwurf einer angeblichen „arglistigen Täuschung“ gegenüber der Universität Bonn zurückzuweisen. Der Westend Verlag unterstützt Frau Prof. Dr. Guérot und ihre Rechtsvertretung in diesem Anliegen.
Die „Causa Guérot“ wurde bereits in nationalen und internationalen Medien ausführlich behandelt, unter anderem in einem Beitrag von Thomas Fazi: „Enemy of the State?“
In Reaktion darauf wurde die „Causa Guérot“ als Fallbeispiel in einen Bericht des Europarats aufgenommen. Das Committee on Political Affairs and Democracy in Straßburg bereitet derzeit eine Studie zum Thema „Strengthening freedom of expression: an imperative for the consolidation and development of democratic societies“ (AS/Pol (2025) 15, vom 19. Mai 2025) vor, die im Dezember 2025 veröffentlicht werden soll.
Eine Auswahl von Artikeln und Videos zum Fall Guérot findet sich unter www.ulrike-guerot.de in der Rubrik „Causa Guérot“. Dort wird auch ein Link bereitgestellt, der die als „Plagiate“ bezeichneten Zitierfehler transparent macht. Der Fall sollte im Sinne der Gleichbehandlung mit anderen bekannten Fällen verglichen werden, etwa mit dem von Prof. Frauke Brosius-Gersdorf. Entscheidend sollte dabei allein der rechtliche Maßstab sein, nicht die politische Haltung der Betroffenen.
Der Westend Verlag hat 2024 die empirische Studie Wer stört, muss weg von Heike Egner und Anke Uhlenwinkel veröffentlicht. Sie untersucht Fälle, in denen Wissenschaftler in den letzten Jahren wegen vermeintlicher ideologischer Abweichungen von ihren Hochschulen entfernt wurden. Die Ergebnisse werfen grundlegende Fragen zur Freiheit von Forschung und Lehre in Deutschland auf. Der Verlag setzt sich gegen jede Einschränkung der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit in Deutschland ein – ein Anliegen, das durch aktuelle Studien gestützt wird. Laut dem Freiheitsindex 2023 (ZEIT/Allensbach) glauben nur rund 40 Prozent der Deutschen, ihre Meinung frei äußern zu können.
Der Westend Verlag möchte mit der Unterstützung der Nichtzulassungsbeschwerde von Frau Prof. Dr. Guérot ein Zeichen für Wissenschaftsfreiheit setzen und hofft, dass sich weitere Verlage diesem Anliegen anschließen. Markus J. Karsten erklärte dazu: „Wenn einzelne Zitierfehler, die weniger als zwei Prozent des Buchumfangs betreffen, bereits als Plagiate gewertet werden, müsste man den größten Teil populärwissenschaftlicher Literatur unter denselben Verdacht stellen.“
Markus J. Karsten
Verleger Westend Verlag Die Rechtsanwälte von Prof. Dr. Ulrike Guérot äußern sich in folgender Pressemeldung ergänzend zu den juristischen Hintergründen:
Pressemitteilung
Nr. 1 im Verfahren Professor Dr. Guérot gegen Uni Bonn
der Rechtsanwälte auf der Heiden/Gall
vom 13. November 2025
Embargo: Mittwoch, 13. November 2025, 14:00 Uhr
Wissenschaftsfreiheit in Gefahr: Prof. Dr. Ulrike Guérot legt Beschwerde beim Bundesarbeitsgericht ein
Berlin/Karlsruhe. Die Politikwissenschaftlerin Universitätsprofessor Dr. Ulrike Guérot hat gegen das Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) Köln vom 16. Mai 2025 (Az. 10 SLa 289/24) Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesarbeitsgericht (BAG) einlegen lassen. Die Mandantin der Rechtsanwälte Christian auf der Heiden und Tobias Gall hält die Zurückweisung ihrer Berufung für juristisch fehlerhaft und sieht darin auch einen schwerwiegenden Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit.
Das LAG Köln hatte die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch die Universität Bonn bestätigt und den Vorwurf des Plagiats im Bewerbungsverfahren als ausreichend für eine verhaltensbedingte Kündigung gewertet.
Die Rechtsanwälte von Prof. Guérot kritisieren, dass das LAG zentrale Fragen der akademischen Praxis und der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) völlig außer Acht gelassen habe. Stattdessen habe sich das Gericht ohne eigene Sachkunde als wissenschaftliches Fachgremium aufgespielt: Das LAG hat ohne Hinzuziehung externer Sachverständiger oder wissenschaftlicher Fachkunde selbst über die „Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis“ befunden.
Das Urteil des LAG stützt die Kündigung auf Plagiatsvorwürfe, deren tatsächlicher Anteil in den relevanten Werken – selbst nach den Feststellungen des LAG – weniger als 2 Prozent betrage. Die Anwälte von Prof. Guérot halten diese Schlussfolgerung, dass bereits eine derart geringe Quote eine Täuschung im Bewerbungsverfahren zur Professorin begründen soll, für juristisch unhaltbar und realitätsfern. Die Entscheidung ignoriere zudem, dass es sich bei den betroffenen Veröffentlichungen der renommierten Politikwissenschaftlerin nicht um klassische wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten, sondern um für ein breites Publikum gedachte politische Essays gehandelt habe.
Tobias Gall, Rechtsanwalt von Prof. Dr. Guérot: „Das Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln ist in seinen Konsequenzen für die Wissenschaftsfreiheit hochproblematisch. Dass ein Gericht eine Kündigung einer Professorin für wirksam erachtet, allein auf Basis einer richterlichen Entscheidung, die sich ohne jede politologische Fachkunde in wissenschaftliche Bewertungsfragen einmischt und dabei die Verhältnismäßigkeit völlig aus dem Blick verliert, stellt einen gefährlichen Präzedenzfall dar. Wir werden die Rechte unserer Mandantin konsequent vor dem Bundesarbeitsgericht verteidigen, um die notwendige Trennung zwischen juristischer Bewertung und wissenschaftlicher Freiheit wiederherzustellen. Das ist nicht nur im Interesse von Prof. Dr. Guérot, sondern aller, denen die Meinungs- und die Wissenschaftsfreiheit noch etwas bedeutet.“
Die Nichtzulassungsbeschwerde wurde fristgerecht von Rechtsanwalt auf der Heiden beim Bundesarbeitsgericht in Erfurt eingelegt. Über die Wirksamkeit der Kündigung der Universität Bonn ist somit noch nicht rechtskräftig entschieden (vgl. § 72a Abs. 4 Satz 1 ArbGG; BAG, Beschluss vom 28. Februar 2008 – 3 AZB 56/07 – Rn. 15).
Vorinstanzen:
LAG Köln: 10 SLa 289/24 (Pressemitteilung des LAG / Volltext der Entscheidung)
ArbG Bonn: 2 Ca 345/23 (Pressemitteilung des ArbG / Volltext der Entscheidung)Vorinstanzen:
LAG Köln: 10 SLa 289/24 (Pressemitteilung des LAG / Volltext der Entscheidung)
ArbG Bonn: 2 Ca 345/23 (Pressemitteilung des ArbG / Volltext der Entscheidung)
Beitragsbild: © Claus Stille