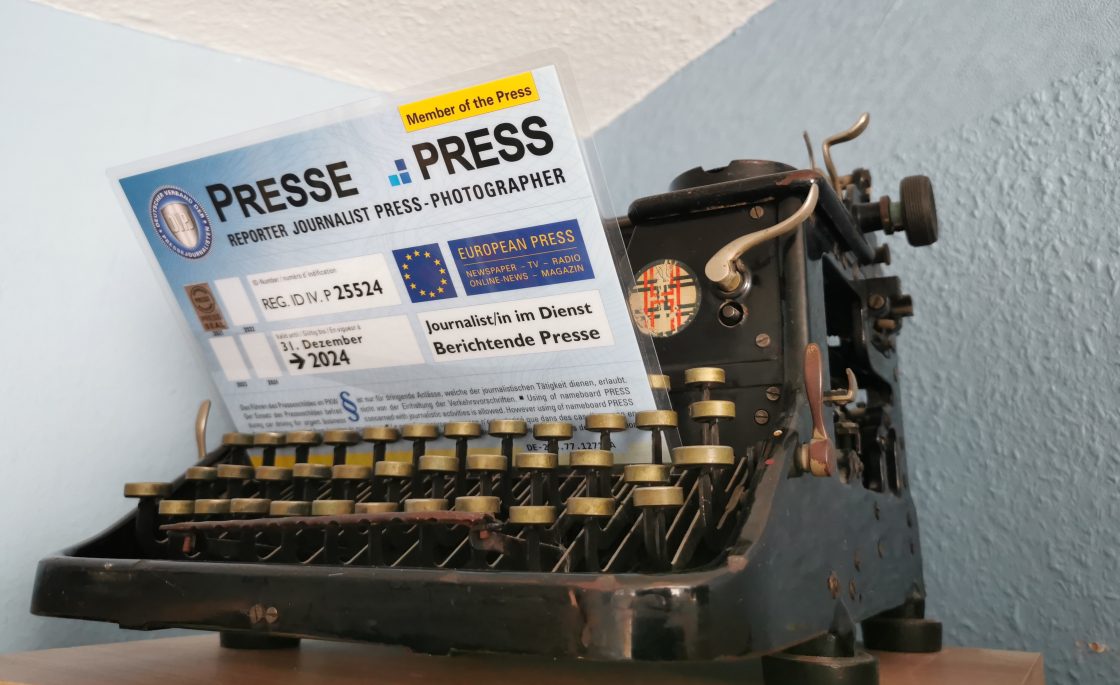OHRENKUSS – Chefredakteurin Katja de Braganca und mit Achim; Foto: Britt Schilling mit freundlicher Genehmigung; Ohrenkuss.
Was als temporäres Forschungsprojekt der Uni Bonn vorgesehen war, behauptet sich zur Freude vieler als nicht mehr wegzudenkendes journalistisches Medium. OHRENKUSS erfährt viel Medieninteresse. Die Zahl der Abonennten erhöhte sich von Jahr zu Jahr. Es dürften jetzt um die 5000 sein. Das Bonner Magazin wurde bereits mit Preisen geehrt. Im vergangenen Jahr wurde der OHRENKUSS fünfzehn Jahre alt.
Zu meiner Kindheit sagte man noch unbedacht Neger zu farbigen Menschen. Jedenfalls dann, wenn wir dieses Wort von unseren Eltern zuvor gehört und damit verinnerlicht hatten. Zumindest traf dieses Nicht-Bedenken wohl in der Regel auf uns Kinder zu. Als die wir den – bei farbigen Mitmenschen (die zu dieser Zeit im Stadtbild meiner Heimatstadt Halle zumeist nur in Gestalt von afrikanischen Studenten vorkamen), wie wir erst später lernten, freilich zu recht negativ besetzten Begriff – ja für völlig normal hielten. Die Dinge aber bleiben nicht so wie sind sind…
Die sind krank, Punkt
Ähnlich unbedacht übernahmen wir später, schon in der frühen Schulzeit, in Bezug auf ab und an im Straßenbild augenscheinlich – im Gegensatz zu uns – eindeutig anders aussehenden Menschen, andere Bezeichnungen, die heute – dem gesellschaftlich errungenen Fortschritt sei es gedankt – ebenfalls längst aus unserem Vokabular gestrichen sind. Wenn wir zu jener Zeit, wohl etwas verwirrt angesichts dieser andersartig wirkenden, uns zuweilen, meist in der Gruppe begegnenden Menschen, Erwachsene über diese befragten, erhielten wir unterschiedliche Antworten. Manche der Erwachsenen sagten uns, es handele sich um mongoloide Menschen. Und Mongolismus sei eben eine Krankheit, Punkt. Oder einfach: Die sind krank. Andere hielten diese Menschen schlicht für bekloppt. Was uns verstörte. Näher nachzufragen, getrauten wir uns nicht. Den meisten Erwachsenen wäre das wohl auch unangenehm gewesen. Das war zu spüren.
Andere Kinder ließen sich sogar dazu verleiten, die Mongoloiden zu verspotten. Man sagt: Kinder können grausam sein. Und es stimmt. Mongoloid bedeutete nichts weiter als dem Mongolen ähnlich. Später, so erinnere ich, hörte ich betreffs dieser Krankheit auch noch die Bezeichnung trisomaler Schwachsinn.
Das Down-Syndrom
Unterschiedliche Begriffe für ein und dieselbe Krankheit, die mehr oder weniger einmal entweder hier oder dort gang und gäbe waren. Inzwischen gehören sie der Vergangenheit an. Nicht nur aus Rücksichtnahme auf das Volk der Mongolen. Man spricht heute betreffs dieser genetisch bedingten Entwicklungshemmungen und Veränderungen des Erscheinungsbildes eines Menschen vom Down-Syndrom. Benannt nach dem britischen Arzt J. L. H. Down. Menschen mit Down-Syndrom haben 47 Chromosomen, eines mehr als die anderen. Bei ihnen ist das 21. Chromosom dreimal vorhanden. Weshalb man auch von einer Trisomie 21 spricht.
Katja de Bragança kam in Madrid die Idee zum Projekt OHRENKUSS
Im Allgemeinen gingen zunächst auch Experten davon aus, dass Kinder mit Down-Syndrom nicht lesen, geschweige denn schreiben können. Vorkommende, scheinbare Gegenbeweise wurden auch von Humangenetikern in der Regel so erklärt: Die Betreffenden hätten die Texte wahrscheinlich irgendwo abgeschrieben. Umso mehr staunte die Humangenetikerin Katja de Braganca, die 1987 auf einer Tagung in Madrid einem interessanten Vortrag mit dem Thema “Lesen und Schreiben – Lernen bei Kindern mit Down-Syndrom” lauscht: Plötzlich bleibt ihr Blick auf einer Overhead-Projektion haften. Darauf zu lesen ist die Geschichte von Robin Hood, geschrieben von einem Jungen mit Down-Syndrom. Katja de Bragança ist damals spontan begeistert. Hauptsächlich von dem witzigen Schreibstil des Autors. Auf der Stelle erinnert sie sich an die Zeit ihrer Diplom- und Doktorarbeit am Bonner Institut für Humangenetik, in der sie viele Menschen mit Down-Syndrom kennengelernt hatte. Unter ihnen befanden sich viele Jugendliche. Und es war durchaus vorgekommen, dass bei Gesprächen mit denen plötzlich jemand äußerst stolz etwas Geschriebene präsentierte. Katja de Braganca verband beide Erlebnisse. Eine Idee begann Gestalt anzunehmen: Eine Zeitschrift, gemacht von Menschen mit Down-Syndrom. Die Idee wurde in die Tat umgesetzt. Die Zeitschrift erhielt den Namen OHRENKUSS. Warum? Es ist leicht erklärt. Ein – “Ohrenkuss…da rein, da raus” – ist so demonstriert: Mit dem Zeigefinger der linken Hand zum linken Ohr hin weisen. Und mit dem Daumen der rechten Hand vom rechten Ohr weg zeigen:

Michael Häger demonstriert den OHRENKUSS; Copyright mit freundlicher Genehmigung von Ohrenkuss.
Da rein, da raus. Was das bedeutet? Vieles geht in den Kopf hinein. Das Meiste geht aber auch wieder hinaus. Nur das Wichtigste bleibt drin. Und dies ist ein OHRENKUSS.
OHRENKUSS fand inzwischen viele Unterstützerinnen und Unterstützer
Vor Jahren sorgte Alfred Biolek , der Dr. Katja de Bragança in seine Talkshow eingeladen hatte dafür, dass das Projekt OHRENKUSS einem breiteren Publikum bekannt wurde. Nicht zuletzt dadurch gewann OHRENKUSS zahlreiche Förderer und hat inzwischen viele Unterstützerinnen und Unterstützer landauf landab. Und den Autoren und der Redaktion von OHRENKUSS macht die Arbeit jedesmal wieder aufs Neue Spass. Der Erfolg gibt dem Projekt recht und macht unablässig Lust, die Arbeit weiter fortzusetzen. Die Volkswagen-Stiftung föderte das Magazin. Das Projekt wurde prämiert. Es erhielt u. a. eine Auszeichnung im Wettbewerb “Demokratie leben”, seitens des damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse.
Scheinbar Gewohntes mit anderen Augen neu erblicken
Den OHRENKUSS zu lesen ist jedesmal wieder ein außergewöhnliches Erlebnis. Die in dem Magazin versammelten Texte kleiden eine auf den ersten Blick ungewohnte Autoren-Sicht auf die Welt und die Dinge des Lebens in oft tief berührende Worte, welche einem als Leser so sicherlich noch nie gekommen sind und uns deshalb in die Lage versetzen können, manches – scheinbar Gewohntes – mit ganz anderen Augen völlig neu zu erblicken.
Die OHRENKUSS-Autoren schreiben ihre Texte selbst auf dem Papier oder am Computer oder diktieren sie. Auf die Schreibweise wird kein Einfluss genommen. Die Texte werden somit auch nicht verbessert. Sie erscheinen dann im Heft genauso wie sie von den Autoren erdacht und geschrieben wurden. Gerade dies verleiht den Texten einen ganz besonders außergewöhnlichen Charakter und hinerläßt bei den Rezipienten des Magazins einen nachhaltigen, wie gleichermaßen nachdenklich stimmenden, nicht selten auch heiteren Eindruck.
In diesen Zustand können sich Interessierte leicht versetzen und dabei gleichzeitig auch noch ein tolles Projekt unterstützen. OHRENKUSS kann nämlich abonniert werden.
Warum mir am Anfang dieses Textes eingefallen ist, dass wir als Kinder nichts dabei fanden, farbige Mitmenschen Neger zu nennen? Ganz einfach: Weil Dinge sich ändern und Menschen zu neuen Erkenntnissen kommen können…
Ältere Berichte über Ohrenkuss finden Sie auf Readers Edtion hier und hier. Recherchen und Redaktion besorgt eine inzwischen aufeinander eingeschworene Journalistentruppe um Chefredakteurin Dr. Katja de Bragança von Bonn aus. Ohrenkuss hat mehrfach mit außergewöhnlichen Texten und Reportagen auf sich aufmerksam gemacht. Zu empfehlen ist die Internetseite des Magazins sowie der Facebook – Aufritt von Ohrenkuss.
Inzwischen existiert sogar ein Film zur Ohrenkuss-Erfindung (produziert von uni-bonn.tv). Alumna der Universität Bonn Dr. Katja de Bragança erzählt darin, wie einst alles begonnen hatte. Und sozusagen eins zum anderen gekommen war. Eigentlich als temporäres Forschungsobjekt geplant, wurde Ohrenkuss inzwischen zu einem nicht mehr wegzudenkenden und viel beachteten journalistischen Medium in Deutschland. Es bereichert die deutsche Presselandschaft wirklich außerordentlich..
Hier geht’s direkt zum Film.