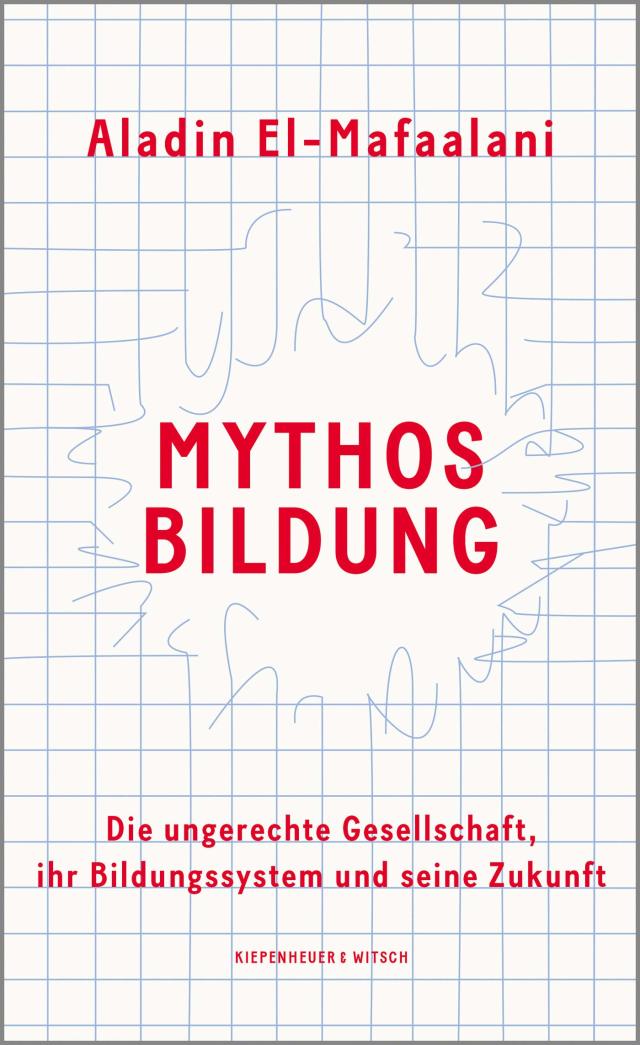(Übernahme von Gewerkschaftsforum.de)
Die Auswirkungen der Reformen der „Agenda 2010“ die von der rot-grünen Bundesregierung Anfang des Jahrhunderts auf den Weg gebracht wurden, haben der politischen Kultur und dem sozialen Klima im Land dauerhaft geschadet. Der Arbeitsmarkt wurde dereguliert, der Sozialstaat demontiert, eine Steuerpolitik betrieben, die den Reichen mehr Reichtum und den Armen mehr Armut gebracht hat und auch der Mittelschicht deutlich gemacht, dass ihr Abstieg jederzeit möglich ist. Damit reagieren die Stärkeren ihre Abstiegsängste, Enttäuschung und ihre Ohnmacht an den Schwächeren ab.
Begleitet wird das Ganze von dem Misstrauen gegenüber den Mitmenschen und wenn man sieht, dass der Staat überall ein Sicherheitsproblem entdeckt, das mit martialischen Einsätzen der Sicherheits- und Ordnungskräfte entschärft werden muss, dann wird die gefühlte Bedrohung real erlebt und nach dem noch stärkeren Staat gerufen.
Dabei ist es erforderlich, denen, die nichts mehr haben, als strafender und disziplinierender Staat entgegen zu treten und den Menschen mit Abstiegsängsten und denjenigen mit großen Vermögen einen starken Staat zu demonstrieren.
Der Bereich in dem der strafende Staat schon seit Jahrzehnten eine besonders tragische Kontinuität an den Tag legt, ist die Ahndung von Bagatelldelikten, die von den ärmeren Menschen begangen werden. Seit den Maßnahmen gegen die Verbreitung des Conoronavirus ist in den großen Städten das aggressive Ausleben der strukturellen und personalen Gewalt von Behörden, Polizei und Ordnungskräften gegenüber armen Menschen bedrohlich angewachsen.
Im Rahmen von „Präsenz zeigen“ und „Null-Toleranz“ gegenüber der ärmeren Bevölkerung in der Stadt, boten die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus und die behördliche Kontrolle über deren Einhaltung, eine neue Gelegenheit, wer den Part von Koch und Kellner in der Kommune einnimmt. Für obdachlose Menschen ist die Rollenaufteilung schon lange grausige Realität
Gejagt von Polizei und Ordnungskräften
Die Menschen auf der Straße erleben hautnah die Ausgrenzung im öffentlichen Raum. Wer gezwungen ist, im Freien zu schlafen, wird aber immer wieder von warmen und relativ geschützten Plätzen vertrieben, weil man ihn dort nicht sehen will, aus Angst vor Geschäftsschädigung, insbesondere im Innenstadtbereich.
Die Stadt Dortmund ist sehr daran interessiert, dass innerhalb des Walls bzw. rund um die Konsummeile Hellweg Armut nicht sichtbar wird. Auch hier geht es um Vertreibung, damit die Konsumenten ohne schlechtes Gewissen die Kassen der Geschäftsleute klingeln lassen. Damit dies ungestört gewährleistet ist, kommt es immer wieder vor, dass obdachlose Menschen mit einem Bußgeld überzogen werden. So geschehen zuletzt, als ein Mann an einem Kiosk am Wall übernachtete und von Mitarbeitern des Ordnungsamtes aufgeweckt wurde. Man verpasste ihm ein Knöllchen wegen „Lagern und Campieren“ in Höhe von 20 Euro, zu überweisen innerhalb von 7 Werktagen. Geht das Geld bei der Stadt nicht ein, droht dem Mann eine Ersatzfreiheitsstrafe.
Dass dieses skandalöse Vorgehen nichts Neues ist, zeigen Zahlen aus dem Jahr 2017, in dem Jahr hat die Stadt Dortmund insgesamt 407 Verstöße gegen „Lagern, Campieren und Übernachten auf öffentlichen Plätzen“ ausgesprochen.
Das folgende Beispiel zeigt, dass sich am Vorgehen der Stadt Dortmund trotz vielfacher Proteste nichts geändert hat.
Seit Mitte Februar 2021 ist der Stadt Dortmund bekannt, dass obdachlose Menschen ein Lager an der Sporthalle Nord in der Nähe eines Städtischen Kindergartens eingerichtet haben. Da sich der Bereich, in dem das Lager errichtet wurde nicht im öffentlichen Raum befindet, konnte das Ordnungsamt keine weiteren Maßnahmen wie Platzverweise aussprechen oder gar eine Räumung durchsetzen, weil Maßnahmen nur über die Ausübung des Hausrechts (z.B. Hausverbote) durchgesetzt werden können. Weil die Durchsetzung von Hausverboten Polizeisache ist, wurde diese um Amtshilfe gebeten und sie sprach den dort angetroffenen campierenden Leuten Platzverweise aus. Die Entsorgung Dortmund wurde beauftragt die Folien, Matratzen, Decken und teilweise auch Lebensmittel als Müll zu verbringen.
Die Maßnahme war jedoch nicht nachhaltig, schon einen Tag später wurden dort 3 Personen schlafend angetroffen. Die Stadt Dortmund forderte die Polizei erneut auf, Platzverweise inklusive Anzeigen auszusprechen und veranlasste, dort eine Absperrung durch Bauzäune anzubringen, um eine weitere Nutzung der Fläche zu verhindern.
Beim Umgang mit den „Problemgruppen“ klebt die Stadt Dortmund seit Jahrzehnten immer an dem gleichen Konzept, das eigentlich gar keins ist, denn mit ihren Ordnungskräften und der Polizei die marginalisierten, kriminalisierten und stigmatisierten Menschen immer nur zu vertreiben und ständig in Bewegung zu halten, jegliches Niederlassen und Ausruhen zu verhindern, ist schlicht nur widerwärtig.
Kontrolle der Einhaltung von Corona- Maßnahmen lassen Situationen eskalieren
Für ausgeschlafene Einwohner in der Stadt Dortmund ist es nichts neues und langjährige reale Praxis, dass obdachlose Menschen mit Ordnungswidrigkeiten drangsaliert werden und saftige Bußgelder zahlen müssen.
Im Rahmen der Kontrollen der Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus wurden obdachlose Menschen systematisch von Polizei und Angestellten des Ordnungsamtes, in fast immer in bis zu 10 Personen umfassenden Einsatztrupps von der Kaufmeile verjagt und mit Bußgeldern überzogen. Auf Ansprache reagieren die Einsatzkräfte äußerst gereizt bis aggressiv und verbieten unrechtmäßig Video- und Fotoaufnahmen von ihrem Handeln.
Widerstand gegen Übergriffe bzw. Rechtsmittel gegen Bußgelder einzulegen ist für die armen Betroffenen keine Lösungsmöglichkeit. Niemand wehrt sich gegen die Bußgelder und der Verwaltungsablauf nimmt schnell Fahrt auf. Die obdachlosen Menschen werden bei Nichtzahlung des Bußgeldes direkt von der Straße für Wochen, manchmal für Monate ins Gefängnis zur Erzwingung gebracht. In der Regel sind bei der Entlassung die Bußgelder noch nicht einmal abgesessen, sondern bestehen weiterhin und oben drauf drohen weitere Vollstreckungen und Gefängnisaufenthalte.
Das Vorgehen der Ordnungskräfte und Behörden im Rahmen der Kontrollen der „Corona- Maßnahmen“ gegen einen obdachlosen Mann, der auf den Rollstuhl angewiesen ist und für das Treffen draußen mit Bekannten in die Mühlen der Ordnungsbehörden geriet, wurde kürzlich endlich einmal in größerer Öffentlichkeit diskutiert. Dies wurde allerdings erst dadurch möglich, dass das Amtsgericht Dortmund ein sensationelles Urteil fällte und die Erzwingungshaft gegen den Mann abgelehnt hatte.
Vorgehen der Ordnungsbehörde
Der Mann hatte im vergangenen Jahr vom Ordnungsamt mehrere Ordnungsgelder wegen Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung und wegen Bettelns erhalten. In relativ kurzer Zeit kamen insgesamt 7.325 Euro plus Verfahrenskosten zusammen, aus insgesamt 17 Delikten, von jeweils 25 Euro bis zu 2.200 Euro Bußgeld. Als der Mann nicht zahlte, wollte die Stadt Dortmund ihn ins Gefängnis schicken, um ihn zur Zahlung zu zwingen. Die Behörde stellte Anträge auf Erzwingungshaft.
Amtsgericht Dortmund lehnt Erzwingungshaft ab
Die Anträge auf Erzwingungshaft hat das Amtsgericht Dortmund im Dezember 2021 abgelehnt und war in seiner Begründung klar und deutlich: „Sinn und Zweck der Erzwingungshaft ist es, einen Zahlungsunwilligen – nicht Unfähigen – zur Zahlung einer Geldbuße zu zwingen.“ Der Betroffene verfüge „über keinerlei Einkommen“ und „lebt ‚von der Hand in den Mund‘“. Es sei „nicht ersichtlich, inwieweit der Betroffene denn seine Lebensführung bei derart hohen Geldbußen und derart bescheidenen Lebensverhältnissen noch einschränken können soll.“
Das Gericht kritisierte auch die konkrete Vorgehensweise des Ordnungsamtes. Bei der Ahndung der Verstöße „ist das Bußgeld in schematischer Anwendung teilweise enorm erhöht worden, was sogar zur Festsetzung eines einzelnen Bußgeldes in Höhe von 2.200,00 € geführt hat. Die offensichtlichen wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen sind dabei nicht berücksichtigt worden.“ Es sei aber „Sache der Bußgeldbehörde schon bei der Ahndung der Ordnungswidrigkeit nur solche Geldbußen festzusetzen, die unter Berücksichtigung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse noch einen angemessenen Sanktionscharakter haben.“ Die Erzwingungshaft soll „ausdrücklich gerade nicht den Zahlungsunfähigen treffen“.
Das Gericht stellte explizit fest, dass eine Erzwingungshaft nicht als Ersatzfreiheitsstrafe missbraucht werden dürfe oder als Gerichte das tun dürfen. Deshalb würden sich Rechtsdezernent und Rechtsamt gegenüber Obdachlosen rechtswidrig verhalten.
———————–
Das Urteil
Amtsgericht Dortmund
Ausfertigung
730 OWi 237/21 [b]
Der Betroffene ist drogenabhängiger und obdachloser Rollstuhlfahrer.

Armut. Foto/Quelle: FotoHiero via Pixelio.de
Die Stadt Dortmund hat in verschiedenen Verfahren gegen den Betroffenen Bußgelder in Höhe von insgesamt 7.325,00 € zuzüglich Verfahrenskosten festgesetzt, die sich im Einzelnen wie folgt ergeben:
AZ Betrag in €
730 Owi 224/21(b) – 25
730 Owi 225/21(b) – 200
730 Owi 226/21(b) – 400
730 Owi 227/21(b) – 800
730 Owi 228/21(b) – 1.400
730 Owi 229/21(b) – 75
730 Owi 230/21(b) – 2.200
730 Owi 231/21(b) – 100
730 Owi 232/21(b) – 250
730 Owi 233/21(b) – 50
730 Owi 234/21(b) – 1.400
730 Owi 235/21(b) – 25
730 Owi 236/21(b) – 50
730 Owi 237/21(b) – 75
730 Owi 238/21(b) – 75
730 Owi 239/21(b) – 100
730 Owi 240/21(b) – 100
Summe: 7.325,00
—————————————–
Nachdem der Betroffene diese Bußgelder nicht bezahlt hat, begehrt die Stadt Dortmund die Festsetzung von Erzwingungshaft gegen den Betroffenen für sämtliche Bußgelder.
II.
Die Anträge auf Anordnung von Erzwingungshaft sind überwiegend unbegründet.
Denn der Betroffene ist zahlungsunfähig hinsichtlich der festgesetzten Bußgelder, die sich teils in enormen Höhen bewegen. Erzwingungshaft kann gern. § 96 Abs.1 Nr.4 OWiG ausdrücklich dann nicht angeordnet werden, wenn Umstände bekannt sind, die Zahlungsunfähigkeit des Betroffenen ergeben.
Solche Umstände sind hier aktenkundig.
Sinn und Zweck der Erzwingungshaft ist es, einen Zahlungsunwilligen – nicht Unfähigen – zur Zahlung der Geldbuße zu zwingen. In diesem Zusammenhang sind die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Betroffenen, seine Verbindlichkeiten, seine Arbeitsfähigkeit und die Höhe der Geldbuße zu berücksichtigen.
Von Zahlungsunfähigkeit ist insbesondere bei Betroffenen auszugehen, die nur über das Existenzminimum verfügen, kein verwertbares Vermögen besitzen und im Blick auf Alter, Ausbildung, Gesundheitszustand oder Arbeitsmarktlage kein oder kein höheres Einkommen erzielen können (vgl. zum Ganzen für viele Göhler, OWiG 16. Auflage, § 96 Rdn 13).
Dementsprechend ist allgemein anerkannt, dass Sozialhilfeempfänger, die in absehbarer Zeit nicht mit der Erlangung einer Arbeitsstelle rechnen können, als zahlungsunfähig anzusehen sind (vgl. OLG Hamm, Beschluss vom 29. November 1990 -Az.: 3Ws739/89).
Der Betroffene verfügt nach den aktenkundigen Feststellungen über keinerlei Einkommen – auch nicht ALG II – oder Vermögen. Zudem liegen auch noch vorrangige Pfändungen gegen den Betroffenen vor. Die Bußgelder resultieren zum größten Teil daher, dass sich der Betroffene im Trinkermillieu zum Biertrinken in der Öffentlichkeit getroffen hat und die Stadt Dortmund insoweit wiederholt wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung Bußgelder verhängt hat. Dabei ist das Bußgeld in schematischer Anwendung teilweise enorm erhöht worden, was sogar zur Festsetzung eines einzelnen Bußgeldes in Höhe von 2.200,00 € geführt hat. Die offensichtlichen wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen sind dabei nicht berücksichtigt worden.
Wie der Betroffene bei Zahlung der festgesetzten Geldbußen auch nur noch annähernd seinen Lebensunterhalt bestreiten können bzw. wie er überhaupt nur ansatzweise in der Lage sein soll, die festgesetzten Geldbußen zu zahlen, ist nicht ersichtlich. Da er obdachlos und drogenabhängig ist und im Rollstuhl sitzt, ist auch unerfindlich, wie sich an dieser Situation etwas ändern soll. Der Betroffene lebt von „der Hand in den Mund“ – teilweise wurden Bußgelder wegen „Bettelns“ festgesetzt – so dass er selbst die geringeren Geldbußen nicht bezahlen können wird, ohne seinen Lebensunterhalt zu gefährden.
Soweit die Verwaltungsbehörde argumentiert, dass auch vermögenslose Personen ,,unter Einschränkung ihrer Lebensführung die notwendigen Mittel“ aufbringen sollen, damit sie sich nicht sanktionslos über Ordnungswidrigkeit hinwegsetzen können sollen, ändert dies nichts an der Zahlungsunfähigkeit des Betroffenen. Auch ist nicht ersichtlich, inwieweit der Betroffene denn seine Lebensführung bei derart hohen Geldbußen und derart bescheidenen Lebensverhältnissen noch einschränken können soll. Insoweit wäre es Sache der Bußgeldbehörde schon bei Ahndung der Ordnungswidrigkeit nur solche Geldbußen festzusetzen, die unter Berücksichtigung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse noch einen angemessenen Sanktionscharakter haben. Die Erzwingungshaft soll lediglich den Willen eines zahlungsunwilligen Betroffenen beugen, aber ausdrücklich gerade nicht den Zahlungsunfähigen treffen. Im Gegensatz zur Ersatzfreiheitsstrafe im Strafrecht ist die Erzwingungshaft gerade nicht ersatzweises Übel für die begangenen Ordnungswidrigkeiten (vgL viele Göhler, OWiG, 16. Auflage, 96 Rdn. 1).
Dortmund, 08.12.2021 Amtsgericht
Dröge
Richter am Amtsgericht
Ausgefertigt
Cavus, Justizsekretärin
Als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
——————————–
Die Stadt Dortmund reagiert auf das Urteil, wie gewohnt bockig, ohne Empathie und säuerlich
Eine Anfrage der örtlichen Presse an die Stadt Dortmund wurde erst elf Tagen später beantwortet. Stadtsprecher Maximilian Löchter teilte der Redaktion mit, (Quelle: WAZ vom 21.01.2022) „aus datenschutzrechtlichen Gründen können wird keine Informationen bezüglich eines konkreten Bußgeldverfahrens mitteilen“. Die Anordnung einer Erzwingungshaft sei grundsätzlich auch bei „vermögenslosen Personen“ möglich. Es sei zu prüfen, ob jemand tatsächlich zahlungsunfähig oder nur zahlungsunwillig ist. „Nach der ständigen Rechtsprechung des Landegerichts Dortmund ist in der Regel zumindest die Begleichung der Bußgeldforderung in monatlichen Raten zumutbar, um sich im Ergebnis nicht sanktionslos über Ordnungswidrigkeitentatbestände hinwegsetzen zu können“.
Amnestie aller Bußgelder gegen wohnungs- und obdachlose Menschen
Es wird höchste Zeit, dass die Stadt Dortmund generell ihre Ordnungspolitik gegenüber armen Menschen überdenkt.
Die Entscheidung des Amtsgerichts Dortmund könnte Anlass für konkrete Verbesserungen im Umgang der Behörden mit diesen Menschen sein und die Bußgelddrangsalierung gegen wohnungs- und obdachlose Menschen sofort zu beenden.
Der erste Schritt sollte eine Amnestie aller Bußgelder gegen diesen Personenkreis sein!
Ende des Beitrags vom Gewerkschaftsforum.
„Eine deutliche gerichtliche Klatsche für die Stadt Dortmund hat heute (25. Januar 2022) im Sozialausschuss ein politisches Nachspiel“, schreibt Nordstadtblogger.de. Und weiter: „Die Vertreter:innen mehrerer Parteien wollen wissen, wieso die Stadt Erzwingungshaft zur Durchsetzung von Geldstrafen gegen einen Obdachlosen verhängen lassen wollte, die dieser u.a. wegen Bettelns bekommen hatte – und diese nicht bezahlen konnte. Die Reaktionen aus der Zivilgesellschaft waren und sind heftig – und die Politik will, dass sich die Stadtverwaltung nun erklärt.“
Nordstadtblogger: „Die Fraktion „Die Linke+“ wartet nicht erst die Bewertung ab, sondern spricht von einem handfesten Skandal im Umgang mit Obdachlosen in der Stadt Dortmund: „Ich bin fassungslos. Schlechter hätte das Jahr politisch gar nicht starten können“, betont Fatma Karacakurtoglu, sozialpolitische Sprecherin der Ratsfraktion.
Sie macht nachdrücklich darauf aufmerksam, dass das Amtsgericht sogar explizit festgestellt habe, dass eine Erzwingungshaft nicht als Ersatzfreiheitsstrafe missbraucht werden dürfe. „Oder schärfer ausgedrückt, als Gerichte das tun dürfen: Rechtsdezernent und Rechtsamt verhalten sich gegenüber Obdachlosen rechtswidrig. Dieses Verhalten der Stadt wird Die Linke+ in der nächsten Ratssitzung thematisieren.
Es sei skandalös, wie in Dortmund immer noch mit den Schwächsten der Gesellschaft umgegangen werde. Das müsse endlich aufhören. Die Stadt Dortmund habe eine Verantwortung für jeden Menschen, der hier lebt. Deshalb müsste es die Aufgabe von städtischen Mitarbeitern sein, Obdachlosen zu helfen statt sie zu gängeln. Ihnen Strafzettel in insgesamt unrealistischer Höhe zu verpassen, das sei abartig, so Karacakurtoglu. (…) Eine solidarische Gemeinschaft dürfe jedenfalls keinen Menschen allein lassen. Auch wenn dieser möglicherweise nicht in das gängige Bild des Ordnungsamtes von Sauberkeit und Ordnung passe, fasst Fatma Karacakurtoglu zusammen.“
Quellen: WAZ, Lorenz Böllinger, Martin Lemke, zeit-online, monitor.de, Stadt Dortmund, Amtsgericht Dortmund
Zuerst erschienen auf gewerkschaftsforum.de
Laurenz Nurk, besten Dank für die Überlassung des Beitrags.