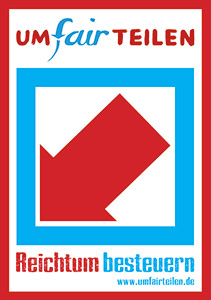Die Vertreterinnen der Dortmunder Mitternachtsmission: Andrea Hitzke, Silvia Vorhauer und Petra Papirowski (v.L.n.r.). Fotos (2): Leopold Achilles
Die Fraktion DIE LINKE & PIRATEN im Dortmunder Rat hatte für vergangenen Mittwoch in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband DIE LINKE Dortmund zu einer Diskussionsveranstaltung über das neue Prostituiertenschutzgesetz eingeladen. Im Dortmunder Rathaus trugen Ulla Jelpke (Bundestagsabgeordnete für DIE LINKE), Andrea Hitzke und zwei weitere Damen von der Mitternachtsmission Dortmund sowie betroffene Frauen aus dem Gewerbe (eine Hauswirtschafterin und eine Prostituierte aus einer Dortmunder Bordellstraße) ihre Meinungen dazu vor und diskutierten mit den Gästen darüber. Und zwar unter der Überschrift „Prostitution zwischen Ausbeutung, Selbstbestimmung und Illegalität“.
Betreffs des Prostituiertenschutzgesetzes standen die Themen Verbot von Sexkauf, Anmeldung von Prostituierten bei den Behörden, das Verbot von Flatratesex, die Kondompflicht und die Bestrafung von Freiern im Mittelpunkt der Diskussion.
Ein „kontrovers und manchmal bis aufs Blut“ diskutiertes Gesetz
Es wurde schon in der Einleitung seitens Christiane Tenbensel deutlich, dass das infrage stehende Gesetz in der Gesellschaft – bis in die Linkspartei hinein – „kontrovers und manchmal bis aufs Blut diskutiert“ wird. Nicht nur einmal ist am Mittwochabend kritisiert worden, dass immer über die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter geredet wird, selten bis nie aber mit den Betroffenen selbst. Im Einzelnen sieht das Gesetz eine von diesen als diskriminierend empfundene Registrierungspflicht vor. Auch eine Beratungspflicht ist vorgeschrieben. Des Weiteren soll eine Kondompflicht (von der jedoch niemand sagt, wer das wie kontrolliert) gelten. Die Betreiber von Bordellen müssen eine Zuverlässigkeitsprüfung bestehen.
Für Ulla Jelpke stellt das Prostitutionsschutzgesetz „ein Generalverdacht für alle Prostituierte“ dar
In ihrem Statement machte Ulla Jelpke gleich zu Anfang klar, dass sie keine Anhängerin von Sexarbeitsverboten ist, sondern vehement dafür stehe, die Interessen von SexarbeiterInnen ernstzunehmen und zu vertreten. Jelpke verhehlte nicht, dass es innerhalb der Linkspartei teils sehr harte
Auseinandersetzungen zu diesem Gesetz gibt. Auch bei Veranstaltungen im Lande, etwa mit der Feministische Frauenarbeitsgemeinschaft LISA innerhalb der Linkspartei, wird Ulla Jelpke immer wieder mit der Forderung nach einem Verbot der Prostitution konfrontiert. Das Argument für das Verbieten von Sexkauf laute dort: Die Freier müssten bestraft werden. Ulla Jelpke, die als Hamburgerin unweit der Reeperbahn und mit der Prostitution groß geworden ist, hat infolgedessen schon eine andere Sicht auf die Dinge.
Als einstige Bürgerschaftsabgeordnete hat sie erlebt, was das Einrichten von Sperrbezirken angerichtet kann. Als Prostitution kriminalisiert wurde, hatten sie sich als weibliche Abgeordnete an die Straße gestellt. Sie seien in der Annahme, Huren zu sein, verhaftet worden. Die Freier aber hatte die Polizei unbehelligt von dannen ziehen lassen. Fraglos, räumte Jelpke jedoch ein, sei Prostitution eine Form von Machtstruktur von Kapitalismus und Patriarchat. Darüber müsse kontrovers diskutiert werden. Aber was heiße eigentlich „seinen Körper verkaufen“ in der Sexarbeit? Würde der Körper da besonders geschunden? Schließlich, meinte die Linkspolitikerin, gebe es ja auch andere Arbeiten, die den Körper schwer belasteten. Jedoch bleibe klar: Die Frau verkauft ihren Körper. Eine Entscheidung, die die Frau treffen müsse.
Als Fortschritt bezeichnete Jelpke das 2002 von Rot-Grün gemachte Gesetz zur Legalisierung der Prostitution. Dies, so die Linkspolitikerin später, hätte eigentlich nur einer Weiterentwicklung bedurft. Vor allem eine Krankheitsversicherung und eine Absicherung von Prostituieren im Alter wären wichtig. Klar differenziert werden müsse zwischen den Frauen, die sich explizit dafür entschieden in der Prostitution zu arbeiten, den Frauen, die dies täten um etwa ihre Drogensucht zu finanzieren sowie zwischen Armutsprostitution und der Zwangsprostitution. Zur Bekämpfung davon „gibt es Paragrafen ohne Ende“. Leider vermischten bestimmte Politiker, viele Prominente und Feministinnen wie Alice Schwarzer dies alles. Schwarzer habe beispielsweise immer wieder behauptet, das Prostitutionsgesetz von Rot-Grün hätte Zwangsprostitution gefördert. Dafür existierten aber keine Belege. Laut BKA ging der Menschenhandel sogar zurück. Das schwedische Modell, wonach Freier, die Sexdienste in Anspruch nehmen bestraft werden, ist für Ulla Jelpke keine Alternative.
Eine Vertreterin der Mitternachtsmission sollte das schwedische Modell später als „Augenwischerei“ bezeichnen.
Die Bundestagsabgeordnete erläuterte das Gesetzesvorhaben samt Inhalte von 2015 bis hin zur Wiedereinführung der in Deutschland bereits 1927 abgeschafften Meldepflicht für Prostituierte. Und sie hinterfragte kritisch, warum Frauen erst ab 21 Jahren zur Sexarbeit zugelassen werden sollen: Soldaten dürften ja auch ab 18 Jahre zur Bundeswehr und ein Gewehr abfeuern.
Kurzum stellt das Prostitutionsschutzgesetz für Ulla Jelpke „ein Generalverdacht für alle Prostituierte“ und ein Verstoß gegen die sexuelle Selbstbestimmung dieser Menschen dar. Qualifizierte Fachberatung halte man dagegen für richtig. Ebenfalls sieht die Abgeordnete eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Berufsgruppen. Die Anmeldepflicht werde derzeit juristisch überprüft. Es könnte eine verfassungswidrige Datenerhebung sein. Einzuwenden sei gar, dass dieses Gesetz ein Rückfall in preußische Verhältnisse ist. Dieses Gesetz, da ist sich Ulla Jelpke ziemlich sicher, bewirke das Gegenteil von dem was gewollt sei. Es könne sein, dass in der Prostitution arbeitende Frauen in die Illegalität getrieben würden. Schließlich beträfe das Gesetz auch Frauen, die nur zeitweilig als Sexarbeiterinnen tätig sind. Sexarbeiterinnen würden durch das neue Gesetz nicht etwa geschützt, sondern stigmatisiert und in ein Schattendasein gedrängt. So sieht es die Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Das Gesetz wird abgelehnt.
Vorschläge zum Gesetz von Betroffenen und Verbänden wurden weitgehend ignoriert
Die Dortmunder Mitternachtsmission, die sich für Prostituierte, ehemalige Prostituierte und Opfer Menschenhandel einsetzt, teilt die Kernansichten, welche Ulla Jelpke aussprach. Die Die Vertreterin ergänzte noch: Wie niemand wisse, wie viele Prostituierte (zu denen übrigens auch Männer gehören) in Deutschland tätig sind, könne auch keiner die Zahl von Frauen nennen, welche Opfer von Menschenhandel geworden sind. Die Mitternachtsmission war zur Anhörung im Vorfeld der Erarbeitung des Prostitutionsschutzgesetzes eingeladen. Umso mehr stoße es den Mitarbeiterinnen bitter auf, dass die Kritik von Verbänden daran weitgehend ignoriert wurden und Vorschläge von kompetenten Prostituierten keinerlei Berücksichtigung erfahren hätten. Menschenhandel werde diese neue Gesetz jedenfalls nicht verhindern, so Andrea Hitzke. Der sogenannte Hurenausweis sei nicht nur ein Stigma, sondern könne übrigens auch zu Erpressung und zu Zerstörung von Familien führen.
Freier, wusste sie zu berichten, hätten schon oft geholfen, wenn sie Zwangsprostitution oder Menschenhandel vermuteten. Auch diese Hilfe könne durch die geplanten neuen Bestimmungen möglicherweise zunichte gemacht werden.
Sexarbeiterinnen sollten selbstbestimmt arbeiten können und lernen selbstbewusst zu sein
Die anwesende Sexabeiterin warf ein, dass jede Frau – vorausgesetzt sie „sei nicht behindert im Kopf“ – die Entscheidung treffen dürfen müsse, wie sie arbeite. Sex könne nicht verboten werden. „Das ist für mich sittenwidrig.“ Es bauten sich halt bestimmte Bedürfnisse auf, die eben manche Männer – manchmal auch Frauen – auch bei und mit Prostituierten auslebten. Zum Beruf der Sexarbeiterin gehöre es unbedingt auch zu lernen, ja oder nein zu sagen. Die Frauen müssten motiviert werden, selbstbewusst zu sein und lernen ihren Wert zu erkennen. Wozu ebenfalls gehöre, sich vor Krankheiten zu schützen. Behörden könnten da nicht behilflich sein. Der Mitternachtsmission müssten dagegen mehr Rechte eingeräumt werden. Sie mache eine gute Arbeit. Die Frau kritisierte, dass die Sexarbeiterinnen eine fragwürdige Vergnügungssteuer (quasi für die Freier) an den Staat abführen müssten. Clubs zahlen eine Pauschale.
Unverletzlichkeit der Wohnung in Gefahr?
Ein Besucher der Veranstaltung sah durch das neue Gesetz auch die Unverletzlichkeit der Wohnung gefährdet. Zum Beispiel im Zuge einer Kondompflichtüberprüfung. Am Rande: In Dortmund soll es momentan 60 Wohnungen geben, in denen Prostitution ausgeübt wird.
Jelpkes Eindruck: Große Koalition macht insgesamt eine Politik über die Köpfe der Menschen hinweg
Dass dieses Gesetz eher aus konservativen Kreisen heraus befördert wurde, vermutete ein anderer Besucher. Sollen vielleicht Steuereinnahmen generiert werden – vielleicht durch die Förderung von Großbordellen, deren Besitzer nicht selten in diversen Talkshows säßen? Und was sei bezüglich dieses Gesetzes von der SPD zu erwarten. Von der man sich ja – wie die Mitternachtsmission – viel erwartet hatte. Dazu Ulla Jelpke: „Die SPD knickt bei jeder Sache ein“. Sie habe ja auch für Einschränkungen bei Hartz IV gestimmt oder in Flüchtlingsfrage versagt. Überhaupt habe Jelpke den Eindruck, dass die Große Koalition momentan auf allen Feldern eine Politik über die Köpfe der Menschen hinweg mache. Man „biegt nicht nur immer mehr nach rechts ab“, sondern schränke auch die Rechte der Menschen immer mehr ein.
„Dieses Gesetz wird alles nur noch schlimmer machen“
Fatma Karacakurtoglu (Ratsfrau DIE LINKE) hat sich sorgfältig zum Thema Prostitution informiert. Sie erinnerte daran, dass man es bei dieser Tätigkeit mit „dem ältesten Beruf der Welt“, den sie „für notwendig“ hält, zu tun habe.
„Prostitution ist ein Bestandteil der Gesellschaft. Dieses Gesetz wird alles nur noch schlimmer machen“, war sich Ulla Jelpke sicher.
Jemand aus dem Publikum bezeichnete das Gesetz ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen als „absoluten Schwachsinn“. Warum macht man es dann? Fatma Karacakurtoglu bricht es kurzerhand auf Dortmunder Prostitutionsverbote (Stichwort: Ravensburger Straße) herunter : „Eins und eins zusammenzählen ist nicht die Stärke jeden Politikers.“ Fast ein schönes Schlusswort, wurde allgemein befunden.
Die Diskussionsveranstaltung über das neue Prostitutionsschutzgesetz im Saal Rothe Erde im Dortmunder Rathaus wurde an diesem Mittwochabend von Besuchern wie Referentinnen als wichtig und richtig empfunden. Es wird darüber hinaus gewiss weitere Diskussionen über das Thema Prostitution und das in dieser Veranstaltung und anderswo heftig kritisierte sogenannte „Prostitutionsschutzgesetz“ geben. In diesem Kreis war man sich weitgehend einig, dieses Gesetz abzulehnen.
Doch auch die Befürworter des Gesetzes im Lande sind sich einig. Sie dürften trotz der gut begründeten Kritik deren Gegner daran festhalten und weiter dafür eintreten. Man darf glauben, dass sie es aus wirklicher Überzeugung tun und gut meinen. Doch wir wissen auch: Gut gemeint ist nicht immer gut getan.
—————————————————————————————–
Wie die Anmeldung von Sexarbeiterinnen momentan in Dortmund vonstatten geht
Wie die momentane Registrierung der Prostituierten in Dortmund abläuft, berichtete die bei der Diskussion anwesende Hauswirtschafterin aus der Linienstraße:
Ein Frau, die der Prostitution nachgehen möchte, muss binnen drei Tagen bei der Polizei gemeldet werden. Ein Formular muss ausgefüllt und der Behörde vorliegen. Mit Adresse, Namen und Arbeitsnamen der Frau etc.. Ausweis und Meldebescheinigung muss jederzeit vorgewiesen werden können.
Zum Gesetz
Der „Verein für soziale und politische Rechte von Prostituierten“ Dona Carmen mit einer Information zum Prostitutionsgesetz.