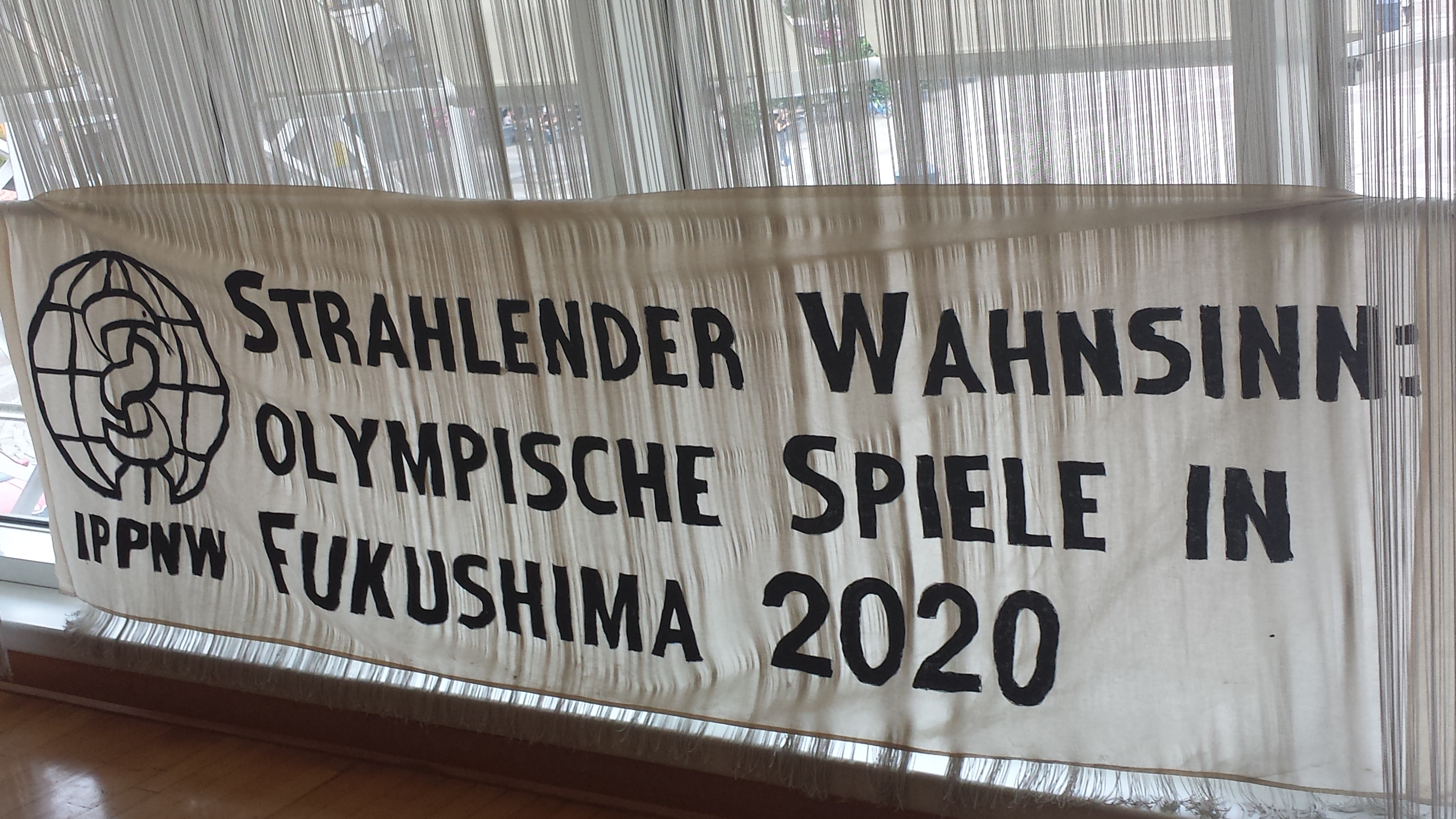Menschen müssen immer auch im Kontext der Zeit verstanden werden, in welche sie hineingeboren und fortan aufgewachsen sind. Und auf welche Weise sie sozialisiert und politisiert wurden. Egon Krenz wurde 1937 in Kolberg (Pommern; heute Kołobrzeg, Republik Polen) geboren. Also zwei Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die Mutter ist eine einfache Frau. Den Vater lernte er nicht kennen. Egon Krenz entstammt kleinsten Verhältnissen. Nun hat Egon Krenz eine Autobiografie vorgelegt. Wenn man darin am Ende liest:
„Honeckers kameradschaftliches Verhältnis zu mir beeindruckte mich. Es war herzlich und produktiv. Das sollte sich in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre, als Gorbatschow in Moskau das Ruder übernahm, ändern. Eine Freundschaft ging zu Ende. Da widerrief Honecker, was im Westen seit Jahren über mich kolportiert worden war, nämlich dass ich sein ‚Kronprinz‘ sei. Doch dazu später.“ Wenn man das richtig versteht, dann dürfte also ein zweiter Teil seiner Erinnerungen folgen.
Egon Krenz zu seinem Vater: „Wer immer mein Vater gewesen sein mag: Er kehrte aus dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder. Die Überzeugung meiner Mutter ‚Nie wieder Krieg!‘ wurde mir gleichsam in die Wiege gelegt. Sie blieb ein Element meines Denkens und Handelns.“
Krenz‘ Entwicklung und dessen Handeln nicht untypisch
Der Verlag schreibt zur Person Egon Krenz: „Seine Entwicklung: nicht untypisch. Sein Handeln ebenso. Egon Krenz, Kriegskind aus Kolberg, fand in Damgarten eine neue Heimat und nahm die Chance wahr, die ihm die neue Ordnung in Ostdeutschland bot. Fördern und fordern, lautete deren Losung für den Umgang mit der jungen Generation. Schickte die Kinder armer Leute an hohe Schulen und vertraute ihnen Funktionen an, die sie unter anderen gesellschaftlichen Umständen nie hätten ausüben dürfen. Die Biografien, die daraus wurden, waren einzigartig. Typisch DDR.“
Der Westen war keine Alternative: „„Bei euch regieren ja immer noch die Nazis“
Krenz schreibt, 1947 als Zehnjähriger, einige Wochen auf Sylt verbracht zu haben, wohin ihn die Mutter zwecks Besuchs ihrer dort lebenden Tochter mitnahm. Der Grenzübertritt gestaltete die Mutter illegal, bediente sich eines Fluchthelfers. Bis nach Westerland in der britischen Zone brauchten die beiden mehrere Tage. Wie selbstverständlich kehrte die Mutter mit Egon wieder nach Ostdeutschland zurück. Ihre Begründung laut Egon Krenz: „Bei euch regieren ja immer noch die Nazis.“
Krenz klärt über den Hintergrund auf: der Bürgermeister von Westerland auf Sylt war von 1951 bis 1964 ein gewisser Heinz Reinefahrth. Studierter Rechtsanwalt, als Generalleutnant der Waffen-SS 1944 Befehlshaber die Niederschlagung des Warschauer Aufstandes befehligt. Unter seinem Befehl seien bis zu 50 000 Polen erschossen worden, schreibt Krenz. 1949 wurde Reinefahrth, der bereits für den US-Geheimdienst CIC arbeitete, 1949 vom Spruchgericht Hamburg-Bergedorf von jeder Schuld freigesprochen. Einem Auslieferungsantrag Polens gegen den Kriegsverbrecher hatte die britische Besatzungsmacht nicht stattgegeben …
Diese Zeilen von Egon Krenz erinnerten mich an eine andere Biografie
Darüber hatte vor vielen Jahren einmal eine Rezension geschrieben hatte. Manfred Liebscher (inzwischen leider verstorben) hatte seine Erinnerungen aufgeschrieben. Die hatte er ursprünglich nur für seine Enkel schreiben zu schreiben gedacht. Schließlich aber veröffentlichte er sie aber dennoch („Im Paradies der Erinnerungen“, Manfred Liebscher; im Netz noch erhältlich). Daraus:
Als Kind einfacher Leute hatte Manfred Liebscher selbst zunächst als Knecht gearbeitet. In den Anfangsjahren der DDR fand er den Weg zur Kasernierten Volkspolizei. Und von dort warb man ihn zum Ministerium für Staatssicherheit ab. Da arbeitete Liebscher für die eigene Kriminalpolizei der Staatssicherheit. Nach dem Ende der DDR rümpfte man die Nase über derartige Biografien. Doch gilt es zu differenzieren. Manfred Liebscher leistete über viele Jahre Wichtiges in seinem Bereich. Das vereinigte Deutschland konnte ihm keine Vergehen oder Straftaten nachweisen. Manfred Liebscher konnte noch eine Weile beim Bundesarchiv in Koblenz arbeiten. Damit seine Enkel verstünden, schrieb er ein Buch für sie. Das es doch noch das Licht der Öffentlichkeit erblickte, war eine gute Entscheidung. Ich empfehle meinen Lesern diese Autobiografie gleichsam als Geschichtsbuch zu lesen. (…)
Die DDR war für ihn “die Heimat der kleine Leute”. Ja: das in vielfacher Hinsicht bessere Deutschland… (…) Hier mein damaliger Beitrag.
Egon Krenz war mit 52 Jahren zwar nur kurz Staats- und Parteichef. Aber er sorgte dafür, dass im Herbst 89 kein Schuss fiel
Als einstiger Bürger der DDR war mir Egon Krenz natürlich bekannt. Ich erinnere mich seiner etwa als er zu meiner Schulzeit als oberster Funktionär der DDR-Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend (FDJ) auf einer Veranstaltung im Blauhemd eine Rede in unserer Stadt hielt. Oft erschien er auch – auf zahlreichen Anlässen abgelichtet – auf diversen Zeitungsseiten oder in Berichten der DDR-Nachrichtensendung „Aktuelle Kamera“, die viele Menschen in der DDR – meine Person eingeschlossen – aber eher selten konsumierten.
Damals schimpften Krenz nicht wenige abschätzig einen „Berufsjugendlichen“. Eine Titulierung, die sie vermutlich aus dem Westfernsehen übernommen hatten. Wer kannte oder traf den Menschen Egon Krenz damals schon persönlich und konnte sich ein einigermaßen objektives Bild von ihm machen? Erst gegen Ende der DDR hatten viele Leute den Menschen Egon Krenz wieder – und zwar positiv! – auf dem Schirm: Für kurze Zeit war er mit 52 Jahren Staats- und Parteichef geworden. „Wenngleich nur für kurze Zeit“, schreibt der Verlag. „Sie genügte jedoch, um Geschichte zu schreiben: Krenz sorgte dafür, dass im Herbst 89 kein Schuss fiel und Frieden im Land blieb.“
Begegnung mit Egon Krenz „tief im Westen“
Anlässlich des 20. Pressefests der DKP-Zeitung „UZ“ (mein Bericht) lief mir der letzte Staatsratsvorsitzende Egon Krenz erstmals ganz nahebei über den Weg. Noch dazu „tief im Westen“, in Dortmund, meiner neuen Heimat. Im Ernst-Thälmann-Zelt stellte er damals sein Buch „China, wie ich es sehe“ vor. Überdies hielt er des einen Tags eine Rede, die heute noch aktuell wäre. Und während des gleichen Pressefests saß er während des Konzerts von Konstantin Wecker am Abend dicht hinter mir. Ich ärgere mich bis heute, ihn nicht angesprochen zu haben, um ihm einige Fragen zu stellen …
Aber nun halte ich ja seine Autobiografie in Händen und erfahre mehr als genug. Freilich wäre eine persönliche Begegnung zugegebenermaßen schon etwas, das mich nach wie vor, interessieren täte. Nun ja …
Krenz‘ Autobiografie: sachlich, hoch interessant und auch Emotionen nicht aussparend
Krenz beschreibt seinen Lebensweg sachlich, hochinteressant, aber gar nicht nüchtern und staubtrocken: denn er offenbart auch seine Emotionen, welche ihn in dieser oder jener Lebensphase beschäftigten und welche Gedanken und auch Bedenken ihn überhaupt jeweils umtrieben. Aus Krenz‘ Zeilen spricht dessen ehrliches Engagement von frühester Jugend an. Von je her hat er es vermieden sich in den Vordergrund zu spielen. Hinterhältigkeit und Falschheit, um Vorteile zu erlangen, waren ihm offenbar schon sehr früh fremd und dementsprechend ein Gräuel. Er hat immer beides verachtet. Dafür war er offen und ehrlich und hat auch – wie zu lesen ist – öfters auch vor Parteifunktionären oder Vorgesetzten, selbst während seines Wehrdienstes bei der Armee nicht gezögert, Kritik zu äußern. Auch wenn ihm das durchaus auch hätte Nachteile betreffs seiner beruflichen wie politischen Entwicklung bescheren können.
Nicht zuletzt dürfte es Krenz mit ziemlicher Sicherheit zugute gekommen sein, dass er vielen Funktionären begegnete, die zuvor den Krieg erlebt hatten, Spanien-Kämpfer, Kommunisten oder engagierte Gewerkschafter gewesen waren. Viele dieser Menschen prägten Egon Krenz.
Ein Bildungsweg, welcher immer wieder Unterbrechungen erfuhr
Sein Bildungsweg verlief durchaus nicht so, wie von ihm gewünscht. Zunächst gedachte er 1953 im Dieselmotorenwerk Rostock eine zweijährige Lehre zum Maschinenschlosser zu machen. Sein altgedienter Meister legte alles daran, ihm betreffs der Herstellung eines Werkstücks „deutsche Werkarbeit“ beizubringen.
Doch bald schon trat im Werk ein Mitarbeiter der FDJ-Bezirksleitung auf den Plan: Man brauche ihn. „An den Lehrerbildungsinstituten fehlen Studenten“, beschied ihm der Mann. Inzwischen war Egon Krenz mit 16 Jahren in die SED eingetreten. Der FDJ-Mann appellierte an Krenz (S.93): „Denk dran, die Partei erwartet von dir, dass du dort hingehst, wo es für unsere Sache am wichtigsten ist!“
Krenz (S.94) schreibt: „Niemand hatte mich gezwungen, in die SED zu gehen. Es war meine eigene Entscheidung gewesen. Wenn die Partei nun von mir erwarte, ich sollte ihrem Ruf folgen, sei dies nur logisch, dachte ich mir.“
Er habe schlaflose Nächte gehabt. „Schließlich entschied ich mich für ‚unsere Sache’“, erzählt Krenz. Er machte das Lehrerstudium. Krenz: „Ich greife vor: Bereut habe ich die Entscheidung nicht. Lehrer wurde mein Traumberuf. Ich bedauerte nur, dass ich ihn nicht lange ausüben konnte.“
Auch Journalist, erfahren wir, wäre Egon Krenz gerne geworden. Doch die Partei stellte ihn immer wieder an andere Stellen. Nur die Nationale Volksarmee (NVA) blitzte bei ihm ab: ein Offizierslaufbahn einzuschlagen, lehnte er ab. Krenz sei verblüfft gewesen, dass der zu Besuch weilende damalige Generaloberst und Vize-Verteidiungsminister Heinz Hoffmann nichts dagegen einzuwenden hatte. Der beschied ihm: „Das ist richtig.“ Auf der Insel Rügen brauchten sie ihn als Funktionär der FDJ. Krenz: Dieses „Kadergespräch“ sei es gewesen, das „mein weiteres Leben bestimmen sollte.“
Warum die NVA-Uniformen weiter deutsch aussehen sollten
Interessant: In seiner NVA-Zeit hatte Egon Krenz Anstoß an der Ähnlichkeit der grauen DDR-Armeeuniform mit jener der faschistischen Wehrmacht genommen. Diese Uniform hatte man ihm auf Nachfrage erzählt, gehe auf die antinapoleonischen Befreiungskriege zurück. Krenz plaudert aus dem Nähkästchen: Die Entwürfe für die NVA-Uniformen ähnelten allein schon in der Farbe denen der Sowjetarmee. Dies sei in einem Gespräch zwischen SED-Chef Walter Ulbricht und KPdSU-Chef Nikita Chruschtschow auf den Tisch gekommen: „Chruschtschow kommentierte: Die DDR-Deutschen hätten wohl Angst sich auf deutsche Traditionen zu besinnen. Warum wollt ihr sowjetische Uniformen? Es reicht doch, wenn die Westdeutschen amerikanische Uniformen tragen. Ihr braucht deutsche Uniformen.“ So kam es dann. Um ein Argument in der Hand zu haben, dass die Ähnlichkeit der NVA-Uniform mit den früheren Wehrmachtsuniformen erklärte, kam dann wohl die oben genannte Erklärung ins Spiel.
Egon Krenz und der 17. Juni
Das Buch ist in vielerlei Hinsicht interessant und informativ. Denn auch kritisches wird nicht ausgeblendet. So schreibt Krenz auch über „Mein 17. Juni“. Im deutschen Westen sei vom „Volksaufstand“ geschrieben worden, in der DDR sein habe es geheißt: „faschistischer Putsch“. Krenz: „Als Schüler habe ich von beidem nichts gespürt.“ Später habe er davon gehört, dass etwa sechs Millionen Beschäftigte in der Industrie und 300 000 an den Aktionen beteiligt gewesen sein sollen.
Krenz: „Als bekannt wurde, dass Aufständische in Halle eine vermutlich ehemalige KZ-Aufseherin aus dem Gefängnis geholt und in einer Stadt im Bezirk Potsdam einen SED-Funktionär barbarisch ermordet hatten sagte ich mir: So etwas macht kein vernünftiger Arbeiter.“
Als einmal im Jahr 2011 kritische Geister in einer Radiosendung betreffs des 17. Juni zu Gericht über die DDR gesessen hatten, fragte sich Egon Krenz, warum da in der Regel die Geschichte ihres eigenen Landes ausgeblendet würde.
Schließlich hätte es doch nach der Einführung der D-Mark im Juni 1948 in den Westzonen als die Preise freigegeben wurden und so für die Masse unbezahlbar geworden seien auch spontane lokale Proteste und einen Generalstreik in der Bi-Zone gegeben. Gegen Unruhen in Stuttgart sei US-Militär mit Panzern und Tränengas vorgegangen. General Clay hatte ein Ausgehverbot verhängt. Es sei der größte Streik in Deutschland seit dem Kapp-Putsch 1920 gewesen.
Hatten „die Freunde“ um Lawrentij Berija ihre Hand im Spiele bei der Auslösung des „Volksaufstandes“?
Zum Thema 17. Juni gehört auch dies, was uns Krenz da eröffnet: Selbst ein SED-Generalsekretär konnte sozusagen nicht dekretieren, dass Stefan Heyms Buch „Fünf Tage im Juni“ in der DDR erscheinen konnte. Erich Honecker war dafür. „Die Freunde“, wie der Große Bruder in Moskau oft in der DDR genannt wurde, sagten jedoch „Njet!“. Moskaus Leute im SED-Politbüro, der Minister für Staatssicherheit Erich Mielke wohl vorn dran, spurten entsprechend. Heym war der historischen Wahrheit zu offenbar zu nahegekommen: Dass nämlich bei der Auslösung des „Volksaufstandes“ vom 17. Juni 1953 sowjetische Kräfte um den potenziellen Stalin-Nachfolger Lawrentij Berija ihre Finger maßgeblich mit im Spiel hatten, Kräfte, die in der DDR lediglich noch die Verfügungsmasse für einen Deal mit dem Westen zur angestrebten Neutralisierung ganz Deutschlands sahen.
Berija wurde übrigens später erschossen.
Orientierungslos nach Stalins Tod
Apropos Stalin. Nach der Wende bezeichneten eigene Genossen Krenz als Stalinist. Der Autor bekennt freimütig, dass er von Stalin einmal viel gehalten hatte. Als er aus dem Radio von dessen Tod erfährt, habe er sich wie gelähmt und geradezu verwaist gefühlt. Im Kapitel „Orientierungslos“ (S.76) hat Krenz darüber geschrieben.
„Was war Stalin nicht alles bis jetzt gewesen? Genius der Epoche, Vater der Völker, Sieger über Hitler, Bester Freund des deutschen Volkes, Führer des Weltfriedenslager … Für mich war er ein Phänomen. Mit politischer Logik allein und trotz Kenntnis, wie Öffentlichkeit wirkt, kann ich seinen Einfluss damals auf mich noch heute nicht erklären. Von Winston Churchill ist der Satz überliefert: Stalin „übernahm das Russland des Hakenpflugs und hinterließ es im Besitz der Atomwaffe“.
Eine Seite weiter schreibt Krenz: „Erst später, als die Mythen fielen und Stalins Verbrechen bekannt wurden, als ich begann, Marx, Engels und Lenin nicht nur zu lesen, sondern auch ihre Gedankengänge zu verstehen, verblasste mir das Heldenbild des Generalissimus. Freilich unter großen Schmerzen und nie vergessend, dass es gesellschaftliche Umstände gab, die sein Handeln begünstigt hatten. Und dass nie vergessen werden darf, dass er der oberste Kommandierende jener Armee war, die Deutschland vom Faschismus befreit hat.“
Viermächteabkommen: Leonid Breshnew stimmte sich eng mit Erich Honecker ab – hinter dem Rücken Walter Ulbrichts
Die Ausführungen in Krenz‘ Kapitel „Abkommen, Anerkennung, Abgrenzung“ (S.217) enthalten Informationen, die zumindest ich so noch nie zuvor irgendwo gelesen hatte. Das Kapitel und behandelt im Besonderen das sogenannte Viermächteabkommen über Berlin, das 1971 zwischen der UdSSR, den USA, Frankreich und Großbritannien abgeschlossen wurde. Man ist erstaunt, zu erfahren, dass sich KPdSU-Chef Leonid Breshnew betreffs dieser Verhandlungen eng mit SED-Politbüromitglied Erich Honecker abstimmte. Der Normalzustand war ja, dass die Besatzungsmacht Sowjetunion bestimmte, was in der DDR umgesetzt werden musste. Wie umgekehrt vorauszusetzen war, dass in Westdeutschland hauptsächlich die westlichen Alliierten – allen voran die USA – bestimmten wie der Hase zu laufen hatte.
Was ja, nebenbei bemerkt, noch heute so zu sein scheint. Würde sich sonst die Bundesregierung wie ein Vasall gegenüber den USA verhalten?
Im Fall des Viermächteabkommens aber legte offenbar der KPdSU-Generalsekretär Breshnew großen Wert auf die Zustimmung der DDR. Tief blicken dabei lässt die Tatsache, dass Breshnew und Honecker hinter Walter Ulbrichts Rücken handelten.
Ebenso ging es beim bemerkenswerten Besuch des damaligen Bundeskanzlers Willi Brandt in Breshnews Urlaubsdomizil Oreanda auf der Krim 1971 am Schwarzen Meer zu. Der Gastaufenthalt Brandts war zwischen dem KPdSU-Generalsekretär und Honecker abgestimmt worden. Brandt und Breshnew am Strand des Schwarzen Meeres beim Baden und bei Bootsfahrten. Was dort besprochen wurde, „erfuhr Honecker noch am gleichen Abend“ – sozusagen brühwarm.
Paranthese: Sehr aufschlussreich ist auch das Kapitel „Zwischen Ulbricht und Honecker“ (S.163). Auch Walter Ulbricht bekommt in Krenz‘ Erinnerung sozuagen ein ganz anderes Gesicht. In westlichen Erzählungen kaprizierte man sich immer hauptsächlich auf dessen Sächseln beim Reden. Und lachte über „Spitzbart“. Ein bisschen ließ man ihn so als eine Art Tölpel aussehen. Egon Krenz (S.172): „Ulbricht war eine Autorität und genoss hohen Respekt. National wie international. ‚In Deutschland hat er‘, urteilte der bürgerliche Publizist Sebastian Haffner über Ulbricht ’nach Adenauers Abgang keinen Gegenspieler, der ihm das Wasser reichen könnte.‘ Der weltläufige Historiker nannte ihn gar den ‚erfolgeichsten deutschen Politiker seit Bismarck.“
Die SPD hat aber ihre Entspannungspolitik nicht mit sich selbst gemacht – ohne die DDR wäre die Ostpolitik der SPD unmöglich gewesen.“
Egon Krenz erinnert sich: „Während Gromyko und Falin noch bis Anfang 1971 versuchten, Ulbricht von der Notwendigkeit des Abkommens zu überzeugen, hatten gleichzeitig Breshnew und Honecker hinter deren Rücken alles bereits besprochen und verabredet: Was für die Entspannung notwendig sei, könne die UdSSR auch im Namen der DDR tun. Breshnew hatt vor der endgültigen Abstimmung der Vier Mächte Honecker gefragt, ob die DDR-Führung mit dem Entwurf des Abkommens einverstanden sei. ‚Völlig einverstanden‘, hatte Honecker erklärt.
Krenz erklärt zur engen Koordinierung: „Die DDR saß zwar nicht mit am Verhandlungstisch, aber ohne ihre Zustimmung wurde nichts vereinbart. Dafür sorgte Breshnew persönlich. Regelmäßig rief er Honecker an, stimmte sich über wichtige Schritte der Verhandlungen mit ihm ab.“
Egon Krenz weist zum Abschluss dieses Kapitels auf eine Fehlstelle hin: „Heutzutage ist es üblich die Ostpolitik der SPD als Beitrag zur Entspannung zu loben. Den Beitrag der DDR kennt kaum jemand. Die SPD hat aber ihre Entspannungspolitik nicht mit sich selbst gemacht – ohne die DDR wäre die Ostpolitik der SPD unmöglich gewesen.“ (S.224)
Egon Krenz auf der Parteihochschule in Moskau und der Unterschied zwischen Kommunismus und Sozialismus
Nicht nur im Kapitel „Parteihochschule Moskau“ erinnert sich Krenz gewiss leicht schlechten Gewissens daran, dass es während seines Aufstiegs in der Politik immer wieder seine Frau Erika (sie starb 2017) war, die ihm immer wieder Kraft gab, obwohl sie oft mit dem Alltag daheim allein da stand. Dabei hätte auch sie durchaus das Zeug dafür gehabt, höher aufzusteigen. Das Studium in der Sowjetunion bedeutete Krenz viel. Er lernte die Leute dort kennen. Schließlich erlernte er die Russische Sprache perfekt sprechen und schreiben. Und da er darauf bestanden hatte mit einem sowjetischen Kommilitonen auf einer Studentenbude zu wohnen, wurde er auch schon mal beschämt. Während er Anzüge und reichlich Kleidung mitgebracht hatte, die kaum in den schmalen Einbaukleiderschrank passten, war sein sowjetischer Stubengenosse Wolodja mehr als bescheiden ausgestattet: „Er öffnete seinen Kleiderschrank. Darin hing eine Hose und eine Jacke. ‚Das ist Kommunismus‘. Dann zeigte er auf meinen vollen Schrank: ‚Das ist euer Sozialismus.’“ (S.157)
Einmal traf Krenz einen Mann am Tag der Oktoberrevolution in einer Runde anderer Menschen. Der besaß nur ein halbes Gesicht. Krenz: „Als er deutsche Worte hörte, belegte er mich mit russischen Flüchen. ‚Ich kann diese Mördersprache nicht hören‘, rief er in den Raum. Krenz schwieg betreten, erzählt er. Krenz entgegnete ihm auf Russisch: „Was sind Sie für ein Kommunist? Marx und Engels waren auch Deutsche!“
Der in der Runde wohl hoch respektierte Mann antwortete: „Sie sind Kommunist?“ Krenz bejahte.
Der Gast, ein in seiner Funktion als Partisanenkommandeur im Zweiten Weltkrieg schwer verwundetet gewesener Mann, schwieg. Er verlangte einen Wodka. Nachdem er das Wasserglas leergetrunken hatte, drückte er Krenz ein gefülltes Glas in die Hand und sprach: „Entschuldigen Sie. Trinken wir auf die Zukunft.“
Egon Krenz früher in ein Licht gesetzt haben, in welches er nicht gehört – den Schuh muss ich mir anziehen
Zugegebenermaßen hielt ich Egon Krenz – wie viele andere führende Genossen – zu DDR-Zeiten für einen der üblichen Apparatschiks in der DDR, noch dazu für einen „Berufsjugendlichen“, wie er ob seiner früheren Funktionen geschimpft wurde. Für einen der Leute eben, die im stocksteifen, ideologiegetränkten Deutsch, in der SED-Propaganda, namentlich im Neuen Deutschland, aber auch andren SED-Blättern und in leicht abgeschwächter Form auch in den Zeitungen der Blockparteien vorkamen. Auch Krenz, der ja vorhatte, Journalist zu werden, kritisiert diese Sprache heute. Und wohl auch damals gefiel es ihm bereits nicht.
Ich fühle, dass ich Egon Krenz damals in ein Licht gesetzt habe, in welches er nicht gehört. Den Schuh muss ich mir anziehen. Da habe ich zu kurz gedacht. Ich muss einiges revidieren.
Menschen müssen immer auch im Kontext der Zeit verstanden werden, in welche sie hineingeboren und fortan aufgewachsen sind, schrieb ich eingangs.
Als die DDR an ihrem Ende stand, wurde jemand wie Egon Krenz einmal mehr verächtlich gemacht und schnell ins Abseits gestellt. Aber er erfuhr auch Beistand
Die Autobiografie ist sehr gut geschrieben. Mit Herzblut, ohne ideologisch oder agitatorisch zu tönen. Es erklärt den Menschen Egon Krenz. Sein Wirken. Und den Anspruch, welcher er dabei an sich selbst gelegt hat. Da wird auch nicht mit Selbstkritik gespart. Auch nicht an Kritik an der DDR und deren führender Partei der SED, sowie an bestimmen politischen Entscheidungen und eingeschlagenen Entwicklungswegen, gerade auch auf ökonomischen Gebiet. All das klingt an. Nun wird es sicher Leserinnen und Leser geben, denen im Buch zu wenig Kritik an der DDR vorkommt. Mag sein. Dann ist das eben so.
Die Lektüre des ersten Bandes von Krenz‘ Erinnerungen ist spannend von Zeile zu Zeile. Es fällt schwer, das Buch wieder aus der Hand zu legen. Und es enthält einiges an Informationen, welche einen entweder so oder eben auch noch gar nicht untergekommen sind.
Als die DDR an ihrem Ende stand, wurde jemand wie Egon Krenz einmal mehr verächtlich gemacht und schnell ins Abseits gestellt.
Aber fast ähnlich wie bei Erich Honecker gab es auch bei Egon Krenz jemand, in dem Fall ein Superintendent, welcher ihm – noch dazu am Heiligen Abend 1989 – versprach, Beistand zu leisten.
Zu lesen gleich im Prolog zum ersten Erinnerungsband. Beide, der Kirchendiener und der vor kurzem noch gewesene Parteidiener, sprachen am Heiligen Abend über Gott und die Welt. Kirchenmann Krätschell sprach Krenz gegenüber, „dass er nun vom Leben beurlaubt sei“. Krenz: „Mit 52 Jahren? Soll alles vergebens gewesen sein, wofür ich seit meiner frühsten Kindheit gelebt hatte?“
Klein ließ sich Krenz durch die und auch durch andere nicht kriegen
Seine Partei, die SED, entledigte sich seiner schnöde. „Manche Weggefährten nannten sich jetzt ‚demokratischen Sozialisten‘, mich einen ‚Stalinisten‘. In der ihrer Partei gebe es keinen Platz für mich, meinten die Eifrigsten. Wirklich kurios. Dieser Partei nannte sich seit einigen Tagen SED-PDS. Ich war seit 1953 in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, aus der diese SED-PDS hervorgegangen war. Die eilig Gewendeten beabsichtigten, mich zum Parteilosen zu machen?“ Krenz entschied sich nicht zu schmollen.
In ihm reifte ein Entschluss, dem er bis heute folgt: „klein kriegen die dich nicht. Ich hatte zwar verloren, war gestrauchelt, gestürzt, aber ich würde nicht liegenbleiben. Ich nicht. Schon um niemanden diesen Triumph zu gönnen, mich Fall gebracht zu haben. Da bin ich wie meine Landsleute hier oben im Norden: eindeutig, stur und beharrlich. Prinzipien brauchen eben einen harten Schädel. Das ist auch gut für die Beulen, die mir nicht nur der politische Gegner zugefügt hat.“
Lest dieses Buch! Auch den Altbundesbürgern rufe ich zu: Wagt es wacker! Greift zu diesem Buch
Leute, lest dieses Buch! Es erweitert den Denkhorizont. Auch wenn in den Altbundesländern sozialisierte Menschen womöglich das Gesicht verziehen mögen (jahrzehntelange Indoktrination sitzt halt tief), wie ich früher, wenn mir meine Mutter Wirsingkohlsuppe vorsetzte: Wagt es wacker! Greift zu diesem Buch.
Zum Buch
»dass ein gutes Deutschland blühe«
Die Memoiren des einstigen Staatschefs der DDR
Der einstige Staatschef der DDR legt seine Memoiren vor. Egon Krenz berichtet über seinen Weg, der nicht untypisch für die DDR und dennoch ein besonderer war und ihn nach Schlosserlehre, Lehrerstudium und Arbeit als Jugendfunktionär zum »Nachwuchskader« der Partei machte. Und, wie alsbald in den Westmedien gemunkelt wurde, zu »Honeckers Kronprinzen«. Als er dessen Nachfolger an der Spitze des Staates wurde, war der Untergang des Landes nicht mehr aufzuhalten. Durch sein gesamtes Leben zieht sich gleichsam leitmotivisch die Vorstellung von einer besseren Gesellschaft, »dass ein gutes Deutschland blühe«, wie es in Brechts »Kinderhymne« heißt, die in jener Zeit entstand, in die auch der Beginn des politischen Lebens von Krenz fällt. Die Memoiren sind auf drei Bände angelegt, setzen je einen zeitlichen Rahmen, sind jedoch nicht chronologisch und linear erzählt. Durch Vor- und Rückgriffe ordnet Krenz seine biografischen Stationen in die Zeitgeschichte ein und wertet aus der Fülle und Differenziertheit der Erkenntnisse seiner langen politischen Laufbahn und natürlich auch jener Erkenntnisse, die er nach dem Untergang seines Staates machen musste. Dadurch bekommt dieser erste – wie auch jeder weitere – Teil der Autobiografie des DDR-Staatsmannes absolute Eigenständigkeit.
Der in Kolberg geborene Krenz berichtet über seine Kindheit, die durch die Kriegsflucht mit seiner Mutter nach Ribnitz-Damgarten 1945 ein ungewolltes jähes Ende fand. Zu diesem Lebensabschnitt gehört der Umstand, dass der siebenjährige Krenz in einer der Massenszene des Ufa-Films »Kolberg« mitspielte. Es sollte der letzte Spielfilm sein, der im untergehenden Reich Premiere hatte. In seiner neuen Heimat, bei den Wahlen 1946, machte Krenz für die CDU Wahlkampf, indem er SED-Plakate überklebte. Aus dieser ersten Begegnung mit Politik entwickelten sich Kontakte, die für ihn prägend wurden und zu seinem entschiedenen Ja zum Sozialismus führten. Wer waren die Leute, die in der DDR Politik machten? Welche Politik? War der Wechsel von Ulbricht zu Honecker eine Umbruchszeit? Krenz erzählt pointiert, verwebt Damaliges mit Heutigem, liefert Fakten, reflektiert seine Erfahrungen tief, kritisch und streitbar. Dadurch entsteht ein dichter, lebhafter, höchst informativer Text, der die Memoiren zu einem herausragenden Leseerlebnis macht und darüber hinaus auch eine Quelle für all jene ist, die sachlich an Geschichte, Politik und einem Nachdenken über die Gesellschaft interessiert sind.
Quelle: edition ost
Egon Krenz
Aufbruch und Aufstieg
Erinnerungen
352 Seiten, 14,5 x 21 cm, gebunden
mit 32 Seiten Bildteil, Lesebändchen, Personenregister
erscheint 02. August 2022
Buch 24,– €
ISBN 978-3-360-02805-1
eBook 19,99 €
ISBN 978-3-360-51052-5
Anbei Video zur Buchpremiere:
Anbei: Interview-Film von TV BERLİN
Ramon Schack interviewt Egon Krenz